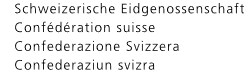Allocuzione del consigliere federale Martin Pfister in occasione dell’evento «Aussenpolitische Aula»
Berne, 29.10.2025 — Allocuzione del consigliere federale Martin Pfister, capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), in occasione dell’evento «Aussenpolitische Aula: Die Sicherheit der Schweiz in unsicheren Zeiten» presso l’Università di Berna, martedì 28 ottobre 2025.
Fa fede la versione orale
Sehr geehrter Herr Nationalrat Pult
Geschätzte Mitglieder des eidgenössischen Parlaments
Werte Vorstandsmitglieder der schweizerischen Gesellschaft für Aussenpolitik
Verehrte Vertreterinnen und Vertreter der Diplomatie und Politik
Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Studierende
Wenn wir über Sicherheitspolitik und Landesverteidigung sprechen, dann ist es naheliegend, über Feinde und Bedrohungen zu sprechen. Ich möchte die Frage zu Beginn umkehren: Nicht, gegen wen wir uns verteidigen, sondern was wir verteidigen, ist wichtig; nicht, wovor wir sicher sein wollen, sondern was wir sichern wollen.
Diese Frage ist nicht einfach zu klären, ist aber letztlich entscheidend. Es gehört zum Sicherheitsbegriff, dass er sehr individuell empfunden wird, aber im politischen Kontext eben doch staatlich beantwortet werden muss. Für die Schweiz und für die Länder Europas lautet die Antwort meines Erachtens: Wir sichern und verteidigen dreierlei: Unsere demokratische Verfasstheit und die Rechtsstaatlichkeit, unsere wirtschaftlichen Lebensgrundlagen und drittens unsere persönliche Integrität.
Diese Feststellung ist historisch gesehen nicht selbstverständlich, wird doch Krieg in der Geschichte meist als Verteidigung oder Eroberung von Territorium und Durchsetzung von politischen Machtinteressen verstanden. Schon viel stärker steht die heutige Sicherheitspolitik in der Tradition der Verteidigung der Systeme, welche im 20. Jahrhundert die klassische Trennlinie war, Faschismus gegen Demokratie, Kommunismus gegen westliche Werte. Aber auch diese Vorstellung von Krieg hat sich verändert. Ich komme darauf zurück.
Die einleitende Frage zu beantworten ist wichtig, weil sich die modernen Bedrohungen genau darauf ausrichten und weil sich in demokratischen Staaten – insbesondere wenn er so wie die Schweiz als Staat der mitverantwortlichen Bürgerin, des engagierten Milizbürgers verstanden wird – die Sicherheitspolitik genau darauf auszurichten hat: Auf die Sicherung der demokratischen Regeln, der wirschaftlichen Lebensgrundlagen und die persönliche Integrität. Sie verstehen natürlich sofort, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Sicherheitspolitik ist zwar eine staatliche Aufgabe, sie hat aber nur wenig mit der Sicherung der Landesgrenzen zu tun.
Mir war es wichtig, dies einleitend festzustellen, bevor ich nun auf den fundamentalen Wandel der geopolitischen Situation zu sprechen komme, den wir heute feststellen müssen. Veränderungen sind zwar normal. Ich plädiere jedoch dafür, die aktuelle Situation als eine radikale Beschleunigung der Veränderung zu verstehen, welche Politik und Gesellschaft sehr ernst nehmen sollten. Mit der Verwendung des Verbs sollen bringe ich auch zum Ausdruck, dass dies noch nicht in genügendem Ausmass der Fall ist.
Die «Zeitenwende», wie der ehemalige deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz die geopolitsche Wende im Februar 2022 kurz nach Beginn des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine in ein Wort fasste, wurde durch den Ukrainekrieg auf besondere Weise sichtbar. Die Zeitenwende ist aber eigentlich eine sich schon länger anbahnende, sich aber in den letzten Jahren beschleunigende Entwicklung. Sie geht einher mit einer deutlichen Verschlechterung der sicherheitspolitischen Lage, weltweit, aber besonders auch in Europa.
Dass wir uns heute im Jahr 2025 wieder mit Krieg beschäftigen müssen, schien lange Zeit unvorstellbar. Nach dem Ende des Kalten Krieges glaubten wir an das viel zitierte Ende der Geschichte von Francis Fukuyama. Wir merken, das Modell der liberalen Demokratie hat sich nicht von selber auf der Welt durchgesetzt. Das Ende des Kalten Krieges hat nicht das Ende der Geschichte markiert, sondern nur eine kurze Pause. Nun erleben wir eine Rückkehr der Geschichte. Und wir erleben damit leider auch eine Rückkehr in eine historische Realität.
Ich möchte diese Zäsur in fünf Punkten zusammenfassen:
Erstens: Die demokratisch verfasste Welt ist durch autoritäre und autokratische Systeme unter Druck gesetzt. Es geht um den Wettbewerb zwischen einer multilataralen Welt weitgehend demokratisch verfasster Staaten oder einer in Einflusssphären aufgeteilten multipolaren Welt. Die demokratischen Länder stehen selbst im Innern unter Druck, durch polarisierte Gesellschaften oder auch durch aktive Einflussversuche von aussen. Sicherheitspolitisch kann ein möglicher Gegner sein Ziel bereits erreicht haben, wenn Verwirrung gestiftet ist, die Deutungshoheit über gesellschaftliche und politische Fragen verändert oder wirtschaftlich und gesellschaftlich Schaden angerichtet wird. Ein moderner Krieg muss nicht mit den klassischen Mitteln militärischer Konfrontation geführt werden. Hybride Konfliktführung wie Cyberangriffe, Beeinflussungsaktivitäten, Desinformation, Spionage, Sabotage, wirtschaftliche Druckausübung, Erpressung und militärische Sonderoperationen reichen aus. Dieser Krieg findet bereits heute in Europa und auch in der Schweiz statt. Der wichtigste staatliche Akteur ist Russland.
Zweitens: Die sogenannte regelbasierte Welt der Ordnung nach dem zweiten Weltkrieg erodiert. Völkerrecht und internationale Organisationen nehmen an Bedeutung ab, beziehungsweise, sie werden zunehmend offen ignoriert. Das ist für die Schweiz als Staat, der nicht auf Macht setzt, und der auf die Einhaltung der Regeln angewiesen ist, ein Problem. Der Einsatz von militärischen Mitteln ist normal geworden, fast überall auf der Welt. Wir dürfen den Nachahmungseffekt nicht unterschätzen, wenn politische Ziele wieder zunehmend mit Gewalt durchgesetzt werden.
Drittens: Wir erleben eine enorme Aufrüstung. Russland hat seine Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt und stockt die Streitkräfte auf. In den USA nennt sich mein Amtskollege nicht mehr Verteidigungsminister, sondern Kriegsminister. Die Verteidigungsausgaben der EU-Länder sind im vergangenen Jahr erneut auf einen Rekordwert gestiegen. Dazu kommt die rasante technologische Entwicklung in den Bereichen Drohnen, Robotik und Cyber.
Viertens: Die Rolle der USA für Europas Sicherheit verändert sich. Der Amtsantritt der neuen US-Regierung Anfang 2025 hat die Umbrüche in den internationalen Beziehungen weiter beschleunigt. Das Verhältnis zwischen Europa und den USA wird grundlegend infrage gestellt. Die USA richten ihre Wirtschafts-, Aussen- und Sicherheitspolitik teilweise neu aus. In der Folge ist in Europa die Überzeugung gewachsen, dass man sich eigenständiger verteidigen und Völkerrecht, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie schützen muss. Europa – einzelne EU-Mitgliedsstaaten sowie auch Nicht-Mitglieder wie Grossbritannien und Norwegen – organisiert sich in einer Vielzahl von sicherheits- und verteidigungspolitischen Initiativen.
Fünftens: Europa steht heute in einem Krieg, in der Ukraine, aber hybrid auch in anderen europäischen Ländern – und auch in der Schweiz. Der Krieg in der Ukraine steht einem nur zum Teil vorbereiteten Europa gegenüber. Die Bedrohungen sind grenzüberschreitend. Die Schweiz ist in allen Fällen einer Eskalation der europäischen Sicherheit mitbetroffen.
Fazit: Es besteht in Europa ein enormes Kriegspotential. Dieses setzt sich zusammen aus einem grossen Reservoir militärischer Mittel auf Seiten Russlands, das in den nächsten Jahren auf einen nicht vollständig entschlossenen Westen und einen Westen, der militärisch noch ungenügend vorbereitet ist, trifft.
Wir kennen die militärischen Absichten Russlands nicht, auch nicht die Oportunitäten, die sich dem Land in den nächsten Jahren bieten. Aber, wer sich für alle Bedrohungen vorbereitet, der ist im Vorteil. Und es ist klar, dass militärische Vorbeitung viel Zeit braucht. Deshalb sollten wir keine Zeit verlieren.
Was machen wir und was müssen wir noch machen?
Wir machen vieles bereits gut:
Die Armee ist nach wie vor nach dem Milizprinzip organisiert, wofür uns viele andere Länder beneiden. Viele motivierte junge Menschen werden in der Armee ausgezeichnet ausgebildet und leisten einen hervorragenden Einsatz. Ich konnte mich davon etwa auf dem österreichischen Waffenplatz Allentsteig überzeugen, wo unsere Milizsoldaten problemlos mit den Profis aus Deutschland und Österreich mithalten konnten. Oder beim Besuch der Swisscoy, wo junge Schweizerinnen und Schweizer höchst anerkannt und verantwortungsvoll wichtige Einsätze in der internationalen Friedensförderung absolvieren. Die Armee konnte in den letzten Jahren alle Einsätze zur Zufriedenheit erfüllen, auch dank fähigem Berufspersonal.
In der Cybersicherheit, wo wir mit dem Bundesamt für Cybersicherheit eine wichtige Institution geschaffen haben, welche diese Risiken zusammen mit vielen Partnern in Wirtschaft, Wissenschaft und Behörden zielgerichtet angeht.
Bei den Polizeikorps, welche mit wenigen Mitteln die Innere Sicherheit gewährleisten.
Oder im Bundesrat und im Eidgenössischen Parlament, wo mit dem Ziel, bis 2032 1% des BIP für die Verteidigung auszugeben, bereits wichtige Entscheide für eine Stärkung unserer Sicherheit gesetzt wurden.
Aber es fehlt auch noch viel: Insbesondere haben wir den Schritt in die Verteidigungsfähigkeit noch nicht geschafft. Es fehlt massiv an Material und an Munition. Wir haben hier einen grossen Nachholbedarf. Er braucht hier einen Schulterschluss und einen Kraftakt.
Damit wir die Grundlagen dazu haben, was wir in den nächsten Jahren tun müssen, legt der Bundesrat der Öffentlichkeit in Kürze eine sicherheitspolitische Strategie vor. Sicherheitspolitik wird darin umfassend beschrieben, weil ein Krieg von heute nicht an einem Tag beginnt und an einem anderen endet.
Deshalb müssen wir:
- unsere Resilienz und Widerstandsfähigkeit erhöhen;
- uns gegen Beeinflussungsversuche von aussen wappnen und Cyberangriffen, Spionage, Desinformation wirksam begegnen können;
- und schliesslich unsere Armee wieder verteidigungsfähig machen – auch für den Worst Case.
Als Vorsteher des VBS ist es meine Verantwortung und Pflicht, die Armee wieder so aufzustellen, dass sie der heutigen Bedrohungslage wirksam begegnen kann. In dieser zunehmend instabilen geopolitischen Lage muss die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz gestärkt, bestehende Fähigkeitslücken geschlossen werden. Einerseits mangelt es – wie erwähnt – an Munition, Systemen und Ausrüstung. Hier sind wir daran, diesen mit den aktuell laufenden Rüstungsbeschaffungen aufzuholen. Dazu gehören etwa die Beschaffung einer umfassenden Luftabwehr mit F-35-Kampfflugzeuge, Luftabwehrsysteme verschiedener Distanz oder Drohnenabwehrsysteme.
In der extrem dynamischen technologischen Entwicklung müssen wir bei den Beschaffungen und Rüstungsgütern agiler werden. Dies zeigt sich exemplarisch im Kommando Cyber, mit hochkompetenten Milizsoldatinnen und -soldaten sowie Profis mit und ohne Uniform, die sich mit allen Aspekten der digitalen Verteidigung befassen. Oder dem Beschaffungszentrum Drohnen und Robotik von Armasuisse, das eng mit der Armee, der Wissenschaft und mit Startups zusammenarbeitet. Am 1. Januar 2026 nimmt das Weltraumkommando der Armee seinen Betrieb auf. Damit reagieren wir auf moderne Bedrohungen.
Weil wir nicht wissen, wie sich der Krieg entwickelt und Beschaffungen von grossem Kriegsmaterial lange dauert, müssen wir uns nicht nur auf die wahrscheinlichste, sondern auch auf die gefährlichste Bedrohung vorbereiten. Dazu gehören nach wie vor auch schwere militärische Mittel wie Panzer oder Artillerie, auch wenn deren Einsatz im Moment nur schwer vorstellbar ist. Eine Lehre aus der Ukraine ist es zweifellos, dass die Kombination der Mittel Jahrzehnte der Entwicklung übergreift. Das Sturmgewehr, der Schützengraben des Ersten Weltkriegs bleiben ebenso präsent wie die Panzer und die Artillerie des Zweiten und die Drohnen des 21. Jahrhunderts. Auch militärisch gilt der Ausdruck des deutschen Philosophen Ernst Bloch, der «Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen».
Geschätzte Damen und Herren
Lassen Sie mich noch ein paar Worte zur internationalen Kooperation sagen, die auch für eine Schweiz, die zu ihrer Neutralität steht, unverzichtbar ist. Unsere Antworten auf die sicherheitspolitischen Herausforderungen müssen heute genauso grenzüberschreitend sein wie die Bedrohungen selbst. Die Wahrung unserer Freiheit gelingt nur im Miteinander, nicht im Alleingang. Wir sind umgeben von Ländern, welche unsere demokratischen und rechtsstaatlichen Werte teilen. Als Land im Herzen Europas sind wir auf gute Beziehungen mit unseren Nachbarn angewiesen. Wer die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz stärken will, muss deshalb auch die internationale Kooperation intensivieren.
Als im September die erwähnten russischen Drohnen in den polnischen Luftraum drangen, haben niederländische F-35-Kampfjets, deutsche Patriot-Raketenabwehrsysteme und italienische Radarflugzeuge die polnischen Streitkräfte bei der Luftabwehr unterstützt. Das zeigt die Wichtigkeit der Kooperation in der Verteidigung.
Die internationale Zusammenarbeit verschafft der Schweiz sicherheitspolitische Handlungsfreiheit. In der Kooperation mit Partnern haben wir die Möglichkeit, unsere eigenen Fähigkeiten zu erweitern. Wenn wir Informationen austauschen, wissen wir mehr. Wenn wir zusammen trainieren, können wir mehr. Wenn wir – auf Grundlage einer eigenen politischen Entscheidung – im Einsatzfall mit unseren Partnern kooperieren, haben wir mehr Aussicht auf Erfolg.
Der Bundesrat will deshalb die internationale Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik mit unseren Nachbarländern und weiteren Partnern intensivieren. Informations- und Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Ausbildung sind gelebte Realität seit vielen Jahren. Es besteht aber weiterhin Spielraum, den es zugunsten der Weiterentwicklung unserer Armee zu nutzen gilt.
Mit der Nato kann die Schweiz bereits auf eine längere Zusammenarbeit zurückblicken. Sie nimmt seit 1996 an der Partnerschaft für den Frieden, Partnership for Peace, teil. Es ermöglicht eine individuelle Zusammenarbeit, bei der wir unsere eigenen Prioritäten setzen können. Unser Fokus liegt dabei bei der Ausbildung, Streitkräfteentwicklung und Rüstung, aber auch bei Einsätzen zur militärischen Friedensförderung und bei der Katastrophenhilfe. In den letzten Jahren ist die Zusammenarbeit im Cyber-Bereich hinzugekommen.
2024 hat die EU das Instrument der «Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft» geschaffen. Damit will sie die sicherheitspolitische Kooperation mit Drittstaaten verstärken. Diese Partnerschaften bilden einen Rahmen für die bestehende sicherheitspolitische Kooperation und deren strategische Weiterentwicklung. Die EU bietet dieses Instrument ausgewählten Drittstaaten an. Der Bundesrat hat deshalb im Juni beschlossen, Sondierungsgespräche mit der EU für den Abschluss einer Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft aufzunehmen.
Bereits gut etabliert ist die Zusammenarbeit des VBS mit der Europäischen Verteidigungsagentur im Bereich der gemeinsamen Forschung und Entwicklung. In den letzten Jahren sind auch Projekte zur gemeinsamen militärischen Ausbildung in spezialisierten technischen Bereichen dazu gekommen.
Neben der Nato und der EU kooperiert die Schweiz mit vielen Staaten auch bilateral. Gerade mit unseren Nachbarstaaten Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich sind viele Kooperationen und gemeinsame Übungen etabliert. Mit der Teilnahme an der von Deutschland lancierten European Sky Shield Initiative vergrössert die Schweiz zudem ihre internationalen Kooperationsmöglichkeiten. Dabei handelt es sich um eine Initiative zur bodengestützten Luftverteidigung Europa mit der Absicht, die Luftverteidigung in Europa zu stärken und die gemeinsamen Anstrengungen besser zu bündeln.
Bei meinem Treffen mit dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius Anfang Oktober waren die jüngsten Drohnensichtungen zentrales Thema. Ein weiteres Thema war die gemeinsame Beschaffung von Waffensystemen sowie das gemeinsame Training – etwa am Patriot-System.
Sehr geehrte Damen und Herren
Lassen Sie mich zusammenfassen: Die aktuelle Sicherheitslage und die geopolitischen Verwerfungen zwingen uns, nach Jahrzehnten einer vermeintlich sicheren Weltordnung uns wieder mit Szenarien auseinandersetzen, die wir nicht mehr für möglich hielten. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Vorstellung einer dauerhaften Friedensordnung in Europa zerstört und die europäische Sicherheitsordnung grundlegend verändert. Darauf muss die Schweiz reagieren. Darauf müssen wir uns vorbereiten, indem wir:
1. Uns umfassend auf die ganze Palette von Risiken vorbereiten und insbesondere unsere demokratische Reslienz stärken;
2. Die Verteidigungs- und Abwehrfähigkeiten der Schweiz stärken;
3. Die internationale Kooperation intensivieren.
Als neutraler Staat hat die Schweiz weiterhin den Anspruch, sich selbst zu verteidigen, statt einer Militärallianz beizutreten. Die Schweiz muss über eine moderne, gut ausgerüstete und verteidigungsfähige Armee verfügen. Als Vorsteher des VBS ist es meine Pflicht, die Armee so aufzustellen, dass sie der heutigen Bedrohungslage wirksam begegnen kann.
Doch es ist noch ein weiter Weg zu gehen. Das ist bei einem solch tiefgreifenden Umbruch der geopolitischen Situation auch normal. Wir brauchen aber jetzt schnell auf gesellschaftlicher und politischer Ebene ein gemeinsames Verständnis, wie wir uns den sicherheitpolitischen Herausforderungen stellen. Nur wenn wir geschlossen sind, können wir auch entschlossen handeln.
Und denken wir daran, entscheidend ist nicht, gegen wen wir uns verteidigen, sondern was wir verteidigen - nicht, wovor wir sicher sein wollen, sondern was wir sichern wollen. Es geht um den Erhalt unserer demokratischen Freiheiten und unserer Rechtstaatlichkeit, die Sicherung unserer wirtschaflichen Lebensgrundlagen und um unsere persönliche Integrität. Alle Bemühungen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik müssen deshalb immer diesem Ziel dienen.
Besten Dank.