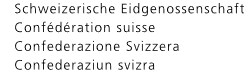Richtig- und Klarstellungen
Das VBS steht für Themen wie Sicherheit, Armee, Bevölkerungsschutz und Sport im Interesse der Öffentlichkeit und ist für Fragen zu diesen Themen Anlaufstelle für Medien und Bürgerinnen und Bürger. Hier finden sich Richtig- und Klarstellungen. Diese werden in der Regel nur in ihrer jeweiligen Sprachversion publiziert.
2025
Die Zeitungen von CH Media berichten in ihren Ausgaben 16. Juli 2025 über die Kündigung von Davide Serrago, Leiter Strategie, Führungsunterstützung und Recht VBS im Generalssekretariat VBS. Andere Medien haben den Artikel ohne weitere Abklärungen übernommen. Im Artikel ist die Rede von Spannungen mit dem Generalssekretär und einem Machtkampf, den Serrago verloren habe. Dabei bezieht sich der Autor auf anonyme interne Quellen.
Die Behauptungen sind falsch.
Richtig ist:- Von Spannungen und einem Machtkampf kann keine Rede sein. Davide Serrago verlässt das VBS nach jahrelanger Tätigkeit im VBS auf eigenen Wunsch, um eine leitende Funktion in der Wirtschaft zu übernehmen. Er ist seit 2010 im VBS in verschiedenen Funktionen tätig. Seit 2017 ist er Geschäftsleitungsmitglied im Generalsekretariat.
- Davide Serrago hat bereits Ende 2024 dem Generalsekretär VBS signalisiert, dass er sich beruflich neu orientieren wolle. Er hatte geplant, im Januar 2025 seine Kündigung einzureichen. Aufgrund des Rücktrittes von Bundesrätin Viola Amherd sah er von einer Kündigung ab. Er teilte mit, dass er in seiner Funktion für eine geordnete Amtsübergabe an Bundesrat Martin Pfister für eine Startphase zur Verfügung steht und mittelfristig eine neue Aufgabe wahrnehmen werde.
In der Ausgabe des Blick vom 01.07.2025 berichtet die Zeitung über die Mehrkosten beim F-35A. Im Artikel werden falsche und irreführende Aussagen zum Umfang und zu den Kosten für die geplante Bewaffnung, der Immobilienprojekte sowie die mittelfristig geplante Weiterentwicklung des Triebwerkes gemacht. Diese Aussagen bedürfen einer Richtigstellung.
Bewaffnung
Der Artikel beschreibt ausschliesslich die Beschaffung der Kurzstreckenlenkwaffe AIM-9X Block II. Ohne Kostenfolge in der Beschaffung des F-35 werden zusätzlich die bei der Schweizer Luftwaffe im Einsatz stehenden Infrarot-Lenkwaffen AIM-9X Block I und Radar-Lenkwaffen AIM-120C AMRAAM weiterverwendet. Die Radar-Lenkwaffe AIM-120 C ist seit 2009 verfügbar und wurde mit den Rüstungsprogrammen 2011 und 2017 - also vor nicht allzu langer Zeit - beschafft. Die Armee wird die AMRAAM-Lenkwaffe bis zum Ende ihrer Nutzungsdauer in den 2040er-Jahren einsetzen. Bei der Version dieser Lenkwaffe handelt sich um ein Modell neuer Generation, die in zahlreichen Ländern auf verschiedensten Typen von Kampfflugzeugen im Einsatz steht. Der F-35A wird somit im gleichen Umfang, wie dies heute beim F/A-18 C/D Hornet der Fall ist, jedoch zusätzlich mit einer moderneren Kurstreckenwaffe (AIM-9X Block II) ausgerüstet.
In der Armeebotschaft 22 wurde zudem transparent ausgewiesen, dass für eine spätere Ersatzbeschaffung der AMRAAM-Lenkwaffe in den Lebenswegkosten 400 Millionen Franken eingerechnet wurden. Solche Ersatzbeschaffungen für Munition waren auch für den F/A-18 C/D notwendig, und es ist falsch, diese jetzt den Beschaffungskosten zuzurechnen.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass im aktuellen Beschaffungsumfang für die Wiedererlangung der Luft-Boden-Fähigkeit darüber hinaus eine geringe Anzahl zweier Typen von Präzisionsmunition beschafft werden. Auch hier wurde in der Armeebotschaft 22 transparent ausgewiesen, dass mit dieser Anzahl nur eine beschränkte Befähigung zur Bodenzielbekämpfung aufgebaut werden kann.Immobilienkosten
Der Artikel unterstellt, dass zusätzlich 180 Millionen für Bauten notwendig würden.
Diese Aussage ist falsch. Richtig ist, dass zusätzlich zu den in der Armeebotschaft 22 ausgewiesenen 120 Millionen Franken aufgrund der Bauteuerung, im aktuellen Sicherheitsumfeld gestiegenen Schutzanforderungen und der Marktpreisentwicklung Mehrkosten von 60 Millionen anfallen.Triebwerk
Im Artikel wird fälschlicherweise behauptet, dass das Triebwerk pannenanfällig sei und allenfalls ersetzt werden muss.
Diese Aussagen zum Triebwerk sind falsch. Der F-35A verfügt mit dem aktuellen F135 Triebwerk über den modernsten und schubstärksten Antrieb westlicher Kampfflugzeuge. Das aktuelle Triebwerk funktioniert sehr zuverlässig und es wurden damit über 860'000 Flugstunden (Stand: Juni 2024) absolviert. Dies ist ein Vielfaches der gesamten Stundenzahl der Schweizer F/A-18 CD. Die Triebwerke der Schweizer F-35A müssen deshalb auch nicht ausgetauscht werden.
Richtig ist: Aufgrund der laufenden Entwicklung sind die genauen Kosten für die beschriebenen zukünftigen Upgrades noch nicht bekannt. Die grossen Stückzahlen wirken sich jedoch vorteilhaft auf die Kosten pro Flugzeug für solche Weiterentwicklungen aus. Bereits heute sind rund 1200 F-35 ausgeliefert, und die Anzahl Flugzeuge wird in Zukunft weiter anwachsen.
Die bereits im Zusammenhang mit verschiedenen Artikeln gemachten Aussagen über das Triebwerk gelten immer noch.- Siehe auch: Stellungnahme des Bundesrates vom 26. Juni 2024 auf die Interpellation von Nationalrat Jean-Luc Addor
- Siehe auch: Stellungnahme des Bundesrates vom 26. Juni 2024 auf die Interpellation von Nationalrat Fabien Fivaz
- Siehe auch: Air 2030 FAQ F-35A
Da diese Verbesserungen zur Zeit erst entwickelt werden, gibt es keine Grundlagen für die vom Blick behaupteten Kosten.
Richtig ist jedoch, dass der Einbau voraussichtlich Ersparnisse in den Lebenswegkosten ermöglichen wird, welche grösser sind als die notwendigen Investitionen.In der Ausgabe des Blick vom 26. Juni 2025 hat die Zeitung im Zusammenhang mit der Kauf des F-35 einen Beitrag veröffentlicht. Darin wird geschrieben, dass im Vertrag mit den Amerikanern bei Vertragsabschluss ein fixer Wechselkurs definiert wurde: 95 Rappen für einen Dollar.
Diese Aussage ist falsch. Richig ist: Es gibt keine Wechselkursvereinbarung im Letter of Acceptance (LOA), da dieser in USD festgelegt ist. Der Fixkurs ist eine Absicherungsmassnahme des Bundes durch die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) bei langjährigen Verpflichtungen in Fremdwährungen (siehe Devisenbeschaffung) und ist nicht ein Bestandteil des LOA’s mit der US-Regierung.Am 4. Juni 2025 hat SRF einen Bericht im Zusammenhang mit Aktivitäten im Bereich Cyber im Zeitraum von 2015 bis 2020 veröffentlicht.
Für Bundesrat Martin Pfister ist ein funktionierender Nachrichtendienst von zentraler Bedeutung für den Schutz und die Sicherheit der Schweiz, gerade in der aktuellen, von Unsicherheit geprägten Weltlage. Er hat deshalb eine Administrativuntersuchung durch eine externe, unabhängige Stelle eingeleitet. Diese wird prüfen, ob die Massnahmen aus den bisherigen Untersuchungen umgesetzt wurden.
Der Chef VBS hat in den vergangenen Tagen die anderen Bundesratsmitglieder, die parlamentarischen Kommissionen GPDel und SiK sowie die EFK informiert.
Der NDB hält diesbezüglich Folgendes fest:1) Die Aufarbeitung von Vorkommnissen im früheren Bereich Cyber des NDB (Zeitraum zwischen 2015 – 2020)
Dazu sind drei Untersuchungen geführt und abgeschlossen worden. Der NDB hatte 2021 eigenständig eine interne Untersuchung initiiert und durchgeführt. Sowohl die Leitung der späteren Administrativuntersuchung als auch die AB-ND hatten für beide Untersuchungen vollständigen Zugang zu allen Informationen, Personen und Dokumenten des NDB, also auch dem geheimen internen Untersuchungsbericht des NDB. Der NDB wurde durch das Departement VBS informiert, dass nun eine weitere Untersuchung durch das Departement durchgeführt werden soll. Der NDB wird – wie bereits bei den beiden vorhergehenden externen Untersuchungen – auch hierfür uneingeschränkt zur Verfügung stehen.
2021, also direkt im Anschluss an die interne Untersuchung, leitete der NDB eine Reorganisation des Bereichs Cyber ein. Diese beinhaltete insbesondere eine neue Aufgabenteilung, die grundlegende Erneuerung der Praxis in der Beschaffung von Cyberdaten, eine Ausweitung der Kontrollmechanismen und eine neue Leitung. Auch wurde der NDB inkl. der Bereich Cyber per 1. März 2024 im Rahmen der laufenden Transformation umfassend reorganisiert. Auch die Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten AB-ND anerkennt, dass der NDB im Januar 2025 plausibel darlegen konnte, dass die Führung des Ressort Cyber verbessert wurde.
Des Weiteren flossen Erkenntnisse aus der Administrativuntersuchung auch in die gegenwärtig laufende Revision des Nachrichtendienstgesetzes (NDG) ein.2) Die Publikation des SRF zu Inhalten eines geheim klassifizierten Berichts des NDB
Die Berichterstattung des SRF stützt sich auf den internen Untersuchungsbericht des NDB, welcher geheim klassifiziert ist.
Gemäss der Verordnung über die Informationssicherheit in der Bundesverwaltung und der Armee ist eine Information als geheim zu klassifizieren, deren Kenntnisnahme durch Unberechtigte u.a. die strategischen Mittel und Methoden der Nachrichtendienste offenlegen, die Durchführung von strategisch bedeutsamen Operationen des NDB gefährden sowie aussenpolitische Interessen der Schweiz schwerwiegend beeinträchtigen kann.
Der NDB bedauert, dass SRF durch eine Publikation zu Inhalten des Berichts potenziell weitreichende Auswirkungen auf die Arbeit des NDB zur Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz bewusst in Kauf nimmt. Das SRF wurde auf diese Risiken – unter anderem auch die allfällige Gefahr der konkreten Bedrohung für Leib und Leben von Personen – mehrfach hingewiesen.
Der NDB kommentiert keine geheimen Berichte gegenüber den Medien. Der NDB hat in diesem Zusammenhang eine Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Bundesanwaltschaft eingereicht wegen des Verdachts der Verletzung des Amtsgeheimnisses. Die Kommunikationshoheit hierzu liegt bei der Bundesanwaltschaft.CH-Media berichtete über Abhängigkeiten von den USA im Zusammenhang mit Beschaffungen von US-Waffensystemen. Der Artikel macht dabei verschiedene falsche Aussagen zum F-35A sowie zum Patriot-System und zu den betreffenden Beschaffungsprojekten.
Das VBS hält dazu fest:
- Eine «Fernsteuerung» oder «Blockierung» der F-35A Kampfflugzeuge, etwa durch äussere Eingriffe in die Elektronik, ist nicht möglich.
- Die Schweiz braucht keine Einwilligung, wenn sie ihre Waffensysteme oder Lenkwaffen zu ihrer Verteidigung einsetzen will. Sie kann dies autonom, selbständig, unabhängig und jederzeit machen.
- Die Schweiz erhält F-35A Flugzeuge aus der laufenden Produktion mit dem gleichen Standart (Block-4) wie alle anderen Kunden und Programmpartner der USA. Dies ist vertraglich mit den USA vereinbart.
- Die Schweiz hat noch nie eine AMRAAM in die USA zu einem Software-Upgrade gesendet. Es ist korrekt, dass es von Zeit zu Zeit Software-Upgrades gibt, welche die Performance der Lenkwaffe verbessern. Es liegt allerdings an der Schweiz selbst, zu entscheiden, ob sie ein Upgrade durchführen wollen oder nicht. Die Lenkwaffen bleiben auch ohne Upgrades jederzeit einsatzbereit. Falls die Schweiz entscheidet, ein Upgrade durchzuführen, dann würden die USA ein sogenanntes «Mobiles Team» in die Schweiz senden, um zusammen mit der Schweiz das Upgrade durchzuführen.
- US-amerikanische Systeme für gesicherte Datenkommunikation mit Link-16 und GPS-Satellitennavigation werden von allen westlichen Kampfflugzeugen und Waffensystemen eingesetzt, auch von den Modellen europäischer Hersteller. Eine vollständige Unabhängigkeit von US-amerikanischer Technologie ist in diesem Bereich nicht möglich, auch nicht mit europäischen Systemen. Allerdings können sowohl auch der F-35A wie auch das Patriotsystem auch ohne Datenlink oder Satellitennavigation wirksam eingesetzt werden.
- Das Patriot System braucht keine «Spezialradardaten», um ballistische Lenkwaffen oder Hyperschallraketen abzuwehren. Das Patriot System ist mit einem Radarsystem ausgestattet, mit welchem das System autonom eingesetzt werden kann.
- Die Schweiz strebt bei der Beschaffung ihrer Waffensysteme eine möglichst grosse operationelle, technische und logistische Autonomie an. Eine vollständige Unabhängigkeit von ausländischen Herstellern wäre aber nur dann möglich, wenn die Systeme und deren Komponenten vollständig in der Schweiz entwickelt würden. Dies ist heute weder der Fall noch ein realistisches oder wirtschaftlich sinnvolles Szenario für die Zukunft.
- Eine besondere Stärke des F-35A ist es, dass dieser dank seiner Sensorik selbstständig ein umfassendes Lagebild erzeugen kann und damit den Pilotinnen und Piloten ein Situationsbewusstsein in allen Aufgabenbereichen ermöglicht. Die entsprechende Datenverarbeitung erfolgt autonom im F-35A.
- Vor und nach dem Entscheid der Schweiz für den F-35A haben sich mehrere europäische Staaten, darunter auch die Nachbarstaaten Italien und Deutschland, ebenfalls für den F-35A entschieden. Der F-35A wird gegen Ende der 20er Jahre eines der meistgenutzten Kampfflugzeuge in Europa sein. Damit bietet der F-35A auch eine Reihe von zusätzlichen Kooperationsmöglichkeiten und eine erhöhte Interoperabilität in Europa, falls die Schweiz dies wünscht.
- Die USA kontrollieren mittels ihrer Exportkontrollpolitik – gleich wie die Schweiz selbst – dass US-amerikanische Waffen nicht ohne Einwilligung der USA an Drittländer weitergegeben werden. Die Schweiz beschafft die Systeme für sich selbst und hat nicht die Absicht, diese weiterzugeben. Entsprechend stellt dies für die Schweiz keine Einschränkung dar.
Der Blick und daraufhin weitere Medien berichteten über den Standort des neuen Luftfahrzeuges auf dem Flugplatz Bern-Belp und die Unterbringung in einem Hangar. Dazu hält das VBS fest:
- Aufgrund der Anforderungskriterien an das neue Staatsluftfahrzeug stand von Anfang an fest, dass für alle im Auswahlverfahren zur Verfügung stehenden bzw. in Frage kommenden Flugzeugtypen bauliche Massnahmen an der Immobilie am Standort in Bern-Belp erforderlich sind. Bereits im Beschaffungsantrag im Jahr 2023 wurde dazu festgehalten, dass der Betrieb und erforderliche Anpassungen an den Immobilien in Bern-Belp sowie allfällige personelle Auswirkungen VBS-intern sichergestellt sind. Die Finanzierung des Betriebs inklusive Stationierung der V-LTDB-Flotte wird somit unabhängig der gewählten Variante auch in Zukunft durch das VBS sichergestellt und bezahlt.
- Ende Januar 2025 fand ein Medienanlass auf dem Flughafen Bern-Belp statt, an welchem das neue Staatsluftfahrzeug den Medien präsentiert wurde. Dabei wurde aufgezeigt, dass die Bombardier Global 7500 voraussichtlich während der ersten zwei Jahre auf dem Militärflugplatz Payerne untergestellt ist, bevor sie fix auf dem Flughafen Bern-Belp nahe der Bundesstadt Bern stationiert sein wird. Die Bombardier Global 7500 wird ab Bern-Belp auch für Langstreckeneinsätze eingesetzt.
- Der LTDB betreibt als einzige staatliche Organisation die strategischen Lufttransportmittel des Bundes. Mit seinen Staatsluftfahrzeugen erbringt der LTDB departementsübergreifende Leistungen (z. B. in humanitären Notlagen, zur Unterstützung von Schweizer Botschaften im Ausland oder zur Wahrung der Interessen des Bundes). Die Luftmobilität der Schweizer Behörden muss dabei jederzeit und weltweit gewährleistet sein. Der Bundesrat hat daher das VBS im Jahr 2022 beauftragt, mögliche Optionen für die Weiterentwicklung der Flotte des LTDB zu prüfen. Die Optionen wurden aufgrund der Bedürfnisse und Anforderungen der Departemente und weiterer Leistungsbezüger sowie der auf dem Markt verfügbaren Flugzeuge geprüft.
- Um die Flexibilität und die Handlungsfreiheit des Bundes zu erhalten, galt es insbesondere, die nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprechende Cessna Citation Excel 560XL zu ersetzen. Mit der sich rasch verschlechternden geopolitischen Lage haben sich auch die Anforderungen an ein Staatsluftfahrzeug markant verändert. Kommt dazu, dass die bestehende Flotte aufgrund des fortgeschrittenen Alters bereits den bisherigen Anforderungen immer weniger gerecht werden konnte. Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse hat gezeigt, dass die Bombardier Global 7500 das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis der verfügbaren Flugzeugtypen aufweist. Mit der Beschaffung einer Bombardier Global 7500 als neues Staatsluftfahrtzeug wird eine deutliche Verbesserung gegenüber der heutigen Flotte in Bezug auf die Reichweite (z. B. weniger Zwischenlandungen und somit Zeitgewinn oder Möglichkeit von Evakuationsflügen über grössere Distanzen), Transportkapazität, Platzangebot und Ausstattung sowie Sicherheit erreicht. Im Zentrum standen und stehen stets der Einsatz und die Auftragserfüllung, nicht die Hangarierung. Die Unterbringungsmöglichkeit dient vor allem dem Unwetterschutz und dem Unterhalt bei jeder Wetterlage.
In einer ersten Fassung ihrer Zusammenfassung eines Interviews von Bundesrätin Viola Amherd, Chefin VBS, schrieb die Nachrichtenagentur Keystone SDA, die Beschaffung der neuen Kampfflugzeuge des Typs F-35A würden sich verzögern. Dies ist falsch. Das Beschaffungsprojekt ist auf Kurs. Die Flugzeuge werden ab 2027 ausgeliefert. Dies war immer schon so geplant. Die SDA hat ihre Meldung inzwischen korrigiert.
2024
Die «Plattform J» berichtet in einem Artikel des Journalisten Beni Gafner von dringenden Aufrufen der «Auslandabteilung des Geheimdienstes» an die Exekutiven von Kantonen und Bund, die Zivilschutzanlagen «zu modernisieren und betriebsbereit zu halten». Als Hintergrund wird auf klassifizierte Einschätzungen zum möglichen Einsatz russischer nuklearer Gefechtsfeldwaffen in der Ukraine verwiesen.
Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB), der den zivilen Inland- wie Auslandnachrichtendienst sicherstellt, hat keine dementsprechenden Empfehlungen abgegeben. Dies würde auch nicht seinem Mandat entsprechen. Die Herkunft der im Artikel publizierten und angeblich klassifizierten Informationen ist dem NDB nicht bekannt.Die NZZ berichtet in ihrer Ausgabe vom 29.10.2024 über die Entschädigung der persönlichen Beraterin von Bundespräsidentin Viola Amherd. Dabei stellt die NZZ falsche Berechnungen auf und zieht auf diesen unwahren Grundlagen tatsachenwidrige Rückschlüsse. Gleichzeitig wirft sie mit diesen irreführenden Darstellungen dem VBS Desinformation vor.
Das VBS weist die Vorwürfe von sich. Richtig ist:
- Die persönliche Beraterin von Bundespräsidentin Viola Amherd wurde per Ende September 2024 pensioniert und arbeitet noch bis Ende des Präsidialjahres im Mandatsverhältnis weiter. Für diese drei Monate wurden die gleichen Arbeitsbedingungen vereinbart wie in der bisherigen Festanstellung.
- Der Auftrag umfasst maximal 70 Tage zu einem Tagessatz von 1'140 Franken. Dies entspricht dem Lohn in der Lohnklasse 31 (224’015 Franken), in welcher die persönliche Beraterin bis zu ihrer Pensionierung angestellt war, und damit ihrer bisherigen Entschädigung. Eingerechnet im Tagessatz sind die gängigen Zuschläge des Bundes sowie der Ferienzuschlag und die Feiertagsentschädigung gemäss Artikel 19 der Verordnung des EFD zur Bundespersonalverordnung, da die persönliche Beraterin kein Anrecht auf Ferien, Feiertage und bezahlte Krankheitstage hat.
- Das VBS leistet zudem die Arbeitgeberbeiträge für die Sozialversicherung im Umfang von maximal rund 12'000 Franken. Auch diese Auslagen fielen bereits während der Festanstellung der persönlichen Beraterin an, wie bei allen Angestellten des Bundes.
- Die persönliche Beraterin kann Spesen bis maximal 5'000 Franken geltend machen; dies ist keine Pauschale, sondern die Aufwände werden gegen Nachweis und gemäss der für die Bundesverwaltung gültigen Spesenentschädigung vergütet.
- Dies ergibt ein gesamtes Kostendach von 97'000 Franken für die Dauer von drei Monaten. Die Berechnungen der NZZ sind somit komplett falsch und nicht nachvollziehbar.
- Den Vorwurf der Desinformation, den die NZZ erhebt, weist das VBS aufs Schärfste von sich. Umgekehrt hat die NZZ wider besseres Wissen falsche Berechnungen publiziert. Das VBS hatte dem Journalisten mitgeteilt, dass die Entschädigungen auf der Lohnklasse der bisherigen Lohnklasse basiert. Dies hat das VBS anschliessend mit Offenlegung der Vertragsbedingungen auch mit Zahlen unterlegt.
In ihrer Ausgabe vom 11.7.24 berichtet die «Weltwoche» über die Personensicherheitsprüfungen von Höheren Stabsoffizieren. Die Zeitschrift schreibt, die Fachstelle für diese Personensicherheitsprüfungen sei dem Staatssekretär für Sicherheitspolitik, Markus Mäder, unterstellt. Dies ist falsch.
Richtig ist: Die Prüfungen für Top-Kader des Bundes, zu denen auch die Höheren Stabsoffiziere gehören, werden von der Fachstelle der Bundeskanzlei durchgeführt. Staatssekretär Markus Mäder hat keinen Einfluss auf diese Prüfungen. Die Fachstelle des SEPOS ist für die Prüfungen aller übrigen Personenkreise zuständig, unter anderem Bundesangestellte, Stellungspflichtige (Rekrutierungszentren), Armeeangehörige. Beide Fachstellen sind weisungsungebunden (siehe Art. 31 Abs. 2 ISG).Die Neue Zürcher Zeitung berichtete in ihrer Ausgabe vom 26. Juni 2024 über die Teilendmontage des neuen Kampfflugzeuges F-35A bei der RUAG in Emmen. Die folgende Textpassage, die RUAG vorgelegt wurde, bedarf einer Richtigstellung:
«Ob bei der Teilendmontage auch gleich neue Turbinen eingebaut würden, sei derzeit noch ungewiss, sagt [RUAG]. Der F-35 gilt zwar als das beste Kampfflugzeug der Welt. Seine Sensoren sind präziser als die anderer Jets, aufgrund seiner Tarnkappenfähigkeit ist der Jet auf dem Radar nicht zu sehen. Doch die Triebwerke des F-35 gelten als pannenanfällig und müssen ausgetauscht werden.»
Die Aussagen sind zum Triebwerk sind falsch:
Der F-35A verfügt mit dem aktuellen F135 Triebwerk über den modernsten und schubstärksten Antrieb westlicher Kampfflugzeuge. Das aktuelle Triebwerk funktioniert sehr zuverlässig und es wurden damit über 860'000 Flugstunden (Juni 2024) absolviert, dies ist ein Vielfaches der gesamten Stundenzahl der Schweizer F/A-18 CD. Die Triebwerke der Schweizer F-35A müssen deshalb auch nicht ausgetauscht werden.
Richtig ist, dass eine Verbesserung eines Triebwerkmodules geplant ist, um für die spätere Weiterentwicklung von Untersystemen den zukünftigen Strom- und Kühlbedarf zu unterstützen. Für die Schweizer F-35A wird die Aktualisierung dieser Triebwerkmodule nach heutiger Planung in den 2030-er Jahre vorgenommen und der Einbau dieser Verbesserung wird sich über mehrere Jahre erstrecken.
Die bereits im Zusammenhang mit verschiedenen Artikeln gemachten Aussagen über das Triebwerke gelten immer noch und haben weiterhin Gültigkeit.Die NZZ berichtet in ihrer Ausgabe vom 14. Juni 2024: «Im Vorfeld der Bürgenstock-Konferenz stellt Viola Amherd in Aussicht, der Ukraine Leopard-l-Panzer zukommen zu lassen.» Auch der Titel suggeriert diese Behauptung. Zudem schreibt der Autor: «Umso erstaunlicher ist, dass Amherd nur ein Jahr später und dieses Mal als Präsidentin der Landesregierung die Tür für Waffenlieferungen an die Ukraine wieder ein Stück weit aufstösst.»
Die Darstellung in der NZZ ist falsch.
Die Schweiz wird der Ukraine keine Leopard-1-Panzer zukommen lassen.
Bundespräsidentin Viola Amherd hat in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt: «Was die Leopard-1-Panzer betrifft, laufen noch verschiedene Untersuchungen und Abklärungen, unter anderem zu den Eigentumsrechten. Sobald die abgeschlossen sind und Klarheit besteht, können wir ein Kaufgesuch von Rheinmetall noch einmal anschauen.»- Siehe Interview FAZ: «Für Frieden braucht es beide Parteien am Tisch»
Verschiedene Medien berichten über die Finanzlage der Armee. Dazu hält das VBS fest:
- Die Darstellung, die Armee könne Rechnungen nicht bezahlen, ist falsch.
- Die Armee bezahlt sämtliche vertraglich vereinbarten Rechnungen dieses und auch die nächsten Jahre, ohne dass es zu einer Budgetüberschreitung kommt.
- Die jahrzehntelang praktizierte und von der Finanzverwaltung nicht monierte Mechanik sieht vor: In der Finanzplanung für Rüstungsbeschaffungen werden jeweils höhere Beträge eingesetzt, als dass vertragliche Verpflichtungen bestehen. Dies, um Projekte, die aus irgendeinem Grund verzögert oder nicht umgesetzt werden, mit anderen notwendigen Beschaffungen zu ersetzen.
Zudem werden Verpflichtungskredite, die für ein bestimmtes Jahr gesprochen werden, nicht vollumfänglich im betreffenden Jahr eingesetzt. Von den geplanten Investitionen in der Höhe von 1.4 Milliarden Franken zur Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit sind rund 70 % noch nicht vertraglich verpflichtet. Das heisst, die Armee kann die Fähigkeitslücken rascher oder langsamer schliessen, je nach Finanzrahmen, den das Parlament beschliesst. Die Planungen sind vorhanden. - Die aktuelle Situation ist nicht aussergewöhnlich. Es gab in den letzten Jahrzehnten immer einen Überhang an Projekten, wenn auch in unterschiedlicher Höhe. Dieser Überhang bewegt sich in den Jahren 2023 und 2024 auf ähnlichem Niveau wie 2014. Im 2025 wird der Überhang unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre liegen.
- Die aktuelle Situation ist finanzpolitisch alles andere als aussergewöhnlich. Sicherheitspolitisch ist sie in der heutigen instabilen Lage mit einem Krieg auf dem europäischen Kontinent, kriegerischen Auseinandersetzungen im mittleren Osten und weiteren Krisenherden auf der Welt schwieriger. Und es muss heute beurteilt werden, ob wir nach Jahrzehnten der Friedensdividende so weiterfahren können wie bis anhin.
- Es handelt sich hier nicht um eine akute Zahlungsunfähigkeit, welche die Armee zu regeln verpasst hätte. Es wurde auch nicht mehr bestellt, als bezahlt werden kann. Bei den 1,4 Milliarden handelt es sich um einen Planwert. Es geht um die Frage: Wieviel ist uns die Sicherheit wert und wollen wir Fähigkeitslücken bis in die 2040er Jahre in Kauf nehmen?
2023
Die Piste des Flughafens Bern-Belp ist genügend lang für das neue Staatsluftfahrzeug des Typs Bombardier Global 7500, das für den Lufttransportdienst des Bundes (LTDB) beschafft wird. Das neue Staatsluftfahrzeug wird Langstrecken ab Bern-Belp fliegen. Anderslautende Darstellungen in verschiedenen Medienberichten vom 1. September 2023 sind falsch. Dazu hält die Luftwaffe fest:
- Rund 98% aller Flüge des LTDB werden ab Bern-Belp betrieben. Da kein Flugzeugtyp dieser Klasse unter Volllast ab Bern-Belp abfliegen kann – weder das aktuelle Staatsluftfahrzeug Falcon noch Charterflugzeuge – fliegt man für einen bis drei Flüge pro Jahr bereits heute ab dem Militärflugplatz Payerne.
- Anders als in den Medien dargestellt, werden mit dem neuen Staatsluftfahrzeug Langstreckenflüge ab Bern-Belp möglich sein. So können zum Beispiel Flüge von Bern-Belp nach Washington D.C. bei Temperaturen bis zu 30 Grad und mindestens 8 Passagierinnen und Passagieren durchgeführt werden.
- Sollten es spezifische Bedürfnisse einmal erfordern, kann die Global 7500 jederzeit und problemlos ab dem nahgelegenen Militärflugplatz Payerne unter Volllast starten und landen. Die Anfahrt für Passagierinnen und Passagiere dauert ab Bern rund eine Viertelstunde länger.
- Mit der Global 7500 erhält der Bund ein Staatsluftfahrzeug auf dem neusten Stand der Technologie bezüglich Sicherheit, Effizienz sowie Leistung. Weitere Informationen siehe Lufttransportdienst des Bundes: neues Flugzeug wird beschafft
Der amerikanische Rechnungshof hat einen Bericht über die Buchführung der Ersatzteile des F-35 durch das amerikanische Verteidigungsministerium veröffentlicht. Der Bericht kritisiert nicht das Logistiksystem des F-35, wie in verschiedenen Medien berichtet wird, sondern die finanzielle Rechenschaftslegung der Ersatzteile durch das amerikanische Verteidigungsministerium.
Die Schweiz wurde als Vertragspartner und künftiger Empfänger von Kampfflugzeugen des Typs F-35A von der amerikanischen Regierung über den Bericht und die darin enthaltenen Resultate des amerikanischen Rechnungshofes vorgängig informiert.
Keine Auswirkungen auf die Schweiz
Der Bericht des amerikanischen Rechnungshofes hat keine Auswirkungen auf die Schweiz, da die Unstimmigkeiten nicht das Logistikinformationssystem für den Betrieb des F-35A betreffen. Die Schweiz verfügt zudem über die vertragliche Zusicherung, dass die nötigen Ersatzteile für die F-35A zur Verfügung stehen.
Weiter trägt die Ausgestaltung des Ersatzlagers dazu bei, die Abhängigkeit von der Anlieferung von Ersatzteilen zu vermindern: Eine Vorgabe für die Bemessung des Logistikpakets für den F-35A ist, dass bei geschlossenen Grenzen und nicht sichergestellter Ersatzteilbewirtschaftung vom und ins Ausland während rund sechs Monaten die Lufthoheit gewahrt und der Ausbildungs- und Trainingsbetrieb aufrechterhalten werden kann.
Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit dem Bericht des amerikanischen Rechnungshofes zu vermerken, dass dank der strengen und transparenten Aufsicht der amerikanischen Behörden auch das betriebliche Umfeld des F-35A dauernd verbessert wird.Verschiedene Medien haben in den vergangenen Tagen über die Ausserdienststellung des Rapiers Boden-Luft-Abwehrsystem berichtet. Dabei ging es auch um die Frage, ob das Herstellerland im Zusammenhang mit der Ausserdienststellung kontaktiert wurde.
Im Zusammenhang mit dieser Frage hält das Bundesamt für Rüstung armasuisse fest:- Während es mit dem Herstellerland keine Kontakte gab, haben auf technischer Ebene zwischen dem Bundesamt für Rüstung armasuisse und dem britischen Hersteller Kontakte stattgefunden.
- Vor der Ausserdienststellung des Rapier-Systems und vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine hat armasuisse im September 2021 den Hersteller des Rapier-Systems offiziell angefragt, wie die kommenden Ausserdienststellung zu handhaben ist. Spätestens ab diesem Zeitpunkt hatte der Lieferant somit Kenntnis gehabt, dass die Schweiz diese Systeme ausser Dienst stellt.
- Aber auch bereits vorher war mit dem Beschluss der Bundesversammlung im Rahmen der Armeebotschaft 2020 bekannt, dass die Ausserdienststellung des Rapier-System beschlossen wurde. Die Entsorgung der Systeme wurde auch in der Armeebotschaft erwähnt. Der Sachverhalt war somit öffentlich.
- Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat der britische Hersteller bei armasuisse im April 2022 angefragt, wie viele Feuereinheiten und Lenkwaffen in der Schweiz einsatzbereit sind. Eine offizielle Anfrage aus Grossbritannien ist in der Folge nicht in der Schweiz eingetroffen.
- Rapier wurde mit den Rüstungsprogrammen 1980 (60 Feuereinheiten und Lenkwaffen Mark 1) und 2001 (Lenkwaffen Mark 2) beschafft und in den Jahren 1984 bis 1986 ausgeliefert. Es kann heutigen Bedrohungen aus der Luft nicht mehr wirksam entgegenhalten. Das System ist gegen Lenkwaffen und Marschflugkörper weitgehend wirkungslos, da diese weit ausserhalb der Reichweite des Systems ausgelöst werden. Mit zunehmendem Systemalter steigen zudem die Instandhaltungskosten stetig an, während die Verfügbarkeit von Ersatzteilen abnimmt. Letzteres führte dazu, dass ganze Systeme zur Ersatzteilgewinnung verwendet und stillgelegt werden mussten. Aus diesen Gründen hat der Bundesrat dem Parlament mit der Armeebotschaft 2020 beantragt, das System ausser Dienst zu stellen.
- Ein grosser Teil der initial beschafften Lenkwaffen (Mark 1) mussten aus Sicherheitsgründen bereits vor dem Ausserdienststellungsbeschluss liquidiert werden. Auch dieser Sachverhalt wurde in der Armeebotschaft erwähnt.
2022
Der Bericht von Keystone-SDA vom 11. Juli 2022 erweckt den Eindruck, dass die Schweizer Armee ganz allgemein bei der Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen keinen Beitrag leistet. Dies ist falsch: Die Schweizer Armee unterstützt das Staatssekretariat für Migration (SEM) jederzeit bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen. Es gilt jedoch eine wichtige Unterscheidung zu machen zwischen kurz- und langfristigen Unterbringungen, welche im erwähnten Beitrag nicht aufgezeigt wird. Ebenfalls wird im Text erwähnt, dass die Armee die Absage damit begründet, dass die Bedürfnisse der Kantone nicht mit den oberirdischen Militäreinrichtungen zusammenpassten. Diese Aussage wurde von Seite der Armee nie so gemacht.
Die Schweizer Armee hält fest:- Kurzfristige Unterbringung: Die Armee unterstützt das SEM (Staatssekretariat für Migration) bei der kurzfristigen Erstunterbringung von aus der Ukraine geflüchteten Personen. Die Schweizer Armee unterstützt diese Art der Unterbringung und stellt dafür bis zu 3'000 Plätze vor allem in Hallen, aber auch in zwischenzeitlich nicht durch die Armee genutzten Kasernen zur Verfügung. Dies entspricht den Eckwerten der gemeinsamen Notfallplanung von Bund und Kantonen im Bereich Asyl, in der auch vereinbart ist, dass das SEM zur Unterbringung in erster Priorität militärische Anlagen des Bundes, die Kantone hingegen in erster Priorität zivile Unterkünfte und Schutzanlagen nutzen.
- Langfristige Unterbringung: Die langfristige Unterbringung von Asyl- oder Schutzsuchenden ist primär Sache der Kantone. Für die langfristige Unterbringung würden von den Armeeinfrastrukturen in erster Linie die Kasernen in Frage kommen. Im Rahmen der Armee-Reorganisationen in den letzten Jahren wurden viele für solche Zwecke geeignete Infrastrukturen abgebaut. Die überirdischen Infrastrukturen, über welche die Armee heute noch verfügt, werden für die Rekrutenschulen und Fortbildungsdienste der Armee benötigt und können nur zeitlich befristet zur Verfügung gestellt werden (was die Armee z.B. mit den Kasernen Bülach und Bure dieses Frühjahr bereits getan hat). Können in einer Notlage trotz der getroffenen Massnahmen nicht mehr alle Asylsuchenden untergebracht werden, können gemäss den Beschlüssen des Sonderstabs Asyl SONAS Notunterbringungsstrukturen (militärische Anlagen, Schutzanlagen, Mehrzweckhallen, Turnhallen etc.) in Betrieb genommen werden.
«Le Temps» behauptet in einem Artikel vom 1. Juni 2022, dass die Schweizer Pilotinnen und Piloten aufgrund der geplanten jährlichen Flugstundenzahl auf dem F-35A einerseits nicht vollständig ausgebildet würden und andererseits die geplante Anzahl Flugstunden auch für die Ausbildung mit den anderen Kandidaten der Kampfflugzeug-Evaluation möglich sei. Beide Darstellungen sind falsch. Weiter wird im Artikel ein Flugstunden-Vergleich mit einer anderen Luftwaffe angestellt und der vorgesehene Ausbildungsweg für junge Pilotinnen und Piloten auf der Basis des Pilatus PC-21 Turbotrainer angezweifelt.
Nachfolgend stellt das Bundesamt für Rüstung armasuisse klar, weshalb die Darstellungen falsch, die Flugstundenzahlen nicht mit anderen Luftwaffen vergleichbar sind und der vorgesehene Ausbildungsweg für die Pilotinnen und Piloten sicher, effizient und nachhaltig ist.
Mit dem F-35A braucht die Luftwaffe weniger Flugstunden als mit Kampfflugzeugen der Vorgängergeneration- Während der Evaluation des neuen Kampflugzeuges hat sich gezeigt, dass beim Betrieb des F-35A rund 20 Prozent weniger Flugstunden im Vergleich zum heutigen F/A-18 C/D oder Kampfflugzeugen der Vorgängergeneration erforderlich sind. Dies deshalb, weil sich auf dem F-35A die Trainingsinhalte dank der besonders einfachen Systembedienung und der Informationsüberlegenheit verändern (siehe Kurzbericht Evaluation Neues Kampfflugzeug, Juli 2021). So verlagern sich zum Beispiel die Kompetenzen der Besatzungen vermehrt in die Rolle eines Missionsmanagers. Auch können komplexe Szenarien im alltäglichen Training teilweise besser im Simulator ausgebildet und geübt werden als in der Luft.
- Die Schweizer F-35A-Besatzungen trainieren mit 5000 Flugstunden pro Jahr ihre Aufgaben mit dem F-35A umfassend und nehmen die alltäglichen Einsätze im Luftpolizeidienst wahr. Sie werden auf dem F-35A gründlich ausgebildet und stellen einen hohen Trainingsstand sicher.
- Auf den anderen Kampfflugzeugen, die an der Evaluation in der Schweiz teilgenommen haben und die nicht über die gleiche Technologie und Informationsüberlegenheit wie der F-35A verfügen, brauchen die Pilotinnen und Piloten mehr Flugtraining – zum Beispiel für die Systembedienung. Deshalb kann die Flugstundenreduktion nicht auf diese Kampfflugzeuge übertragen werden. Diese Erkenntnis aus der Evaluation basiert auf der Beurteilung eines erfahrenen Evaluationsteams, das tausende von Flugstunden in militärischen Schul- und Kampfflugzeugen ausweist – sowohl als Pilotinnen und Piloten, wie auch als Instruktorinnen und Instruktoren.
Die Flugstundenbudgets verschiedener Luftwaffen und Kampfflugzeugtypen können nicht direkt miteinander verglichen werden
- Die Flugstundenbudgets verschiedener Luftwaffen und Kampflugzeugtypen können nicht direkt miteinander verglichen werden. Eine isolierte Betrachtung der Flugstundenbudgets genügt nicht, um die Qualität der Ausbildung und des Trainings zu beurteilen. Für eine umfassende Betrachtung müssen andere Aspekte berücksichtigt werden. Zum Beispiel wie viel Zeit der Flug in den Trainingsraum beansprucht. Weil sich die Trainingsräume in der Schweiz sehr nahe an den Militärflugplätzen befinden, müssen die Pilotinnen und Piloten der Schweizer Luftwaffe dafür vergleichsweise wenig Flugzeit aufwenden.
- Ebenso zu berücksichtigen ist die Qualität und der Umfang der Simulationsmöglichkeiten. Das VBS beschafft für den F-35A vier miteinander vernetzte, moderne Simulatoren, die in einem neuen Trainingscenter auf dem Militärflugplatz Payerne installiert werden. Der F-35A bietet überdies fortschrittliche Möglichkeiten – beispielsweise können im echten Flug andere Flugzeuge simuliert dargestellt werden. Dies erhöht den Nutzen der Flugstunden.
- Bereits heute ist es so, dass die meisten F/A-18 CD-Pilotinnen und Piloten der Schweizer Luftwaffe weniger Flugstunden fliegen als ihre Berufskolleginnen und -kollegen anderer Luftwaffen. Die Teilnahme an gemeinsamen Übungen im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden hat gezeigt, dass das Ausbildungsniveau der Schweizer Luftwaffe ebenso so gut ist, wie das anderer Luftwaffen.
Umschulung vom PC-21 auf den F-35A ist sicher, effizient und nachhaltig
- Die direkte Umschulung vom sehr leistungsfähigen Turbo-Propeller Trainer Pilatus PC-21 auf den F/A-18C/D bewährt sich in der Schweiz seit Jahren. Auch aufgrund des engen Erfahrungsaustausches zwischen der Firma Pilatus, der armasuisse und der Luftwaffe bei der bisherigen Initial- und Weiterentwicklung des PC-21, ist dieser ein vollwertiger Ersatz für einen Jettrainer.
- Dank dem tieferen Treibstoffverbrauch ist die Ausbildung mit dem PC-21 deutlich kostengünstiger und weniger umweltbelastend als mit einem Jettrainer. Dieses Ausbildungskonzept passt zum Umweltleitbild des VBS, das besagt, die Belastungen für die Umwelt und die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.
- Die Ausbildung junger Pilotinnen und Piloten erfolgt auch in Zukunft auf dem Pilatus PC-7 und PC-21 mit anschliessender Umschulung auf den F-35A. Der Umschulungskurs kombiniert das Simulator-Training mit den Flügen im F-35A. Nach einer ersten Phase im Simulator wechseln sich Flüge im Flugzeug und Simulator ab. Der Ausbildungsplan des einsitzigen F-35A hat sich sehr bewährt: Auf dieser Grundlage wurden weltweit schon mehr als 1'600 Pilotinnen und Piloten ausgebildet. Die Erfahrung bei der Ausbildung der grossen Anzahl an Pilotinnen und Piloten fliesst in die Ausbildungspläne ein. Die Erkenntnisse aus der Evaluation und der Austausch mit amerikanischen F-35 Besatzungen und Ausbildnern bestätigen, dass die geplante Vorgehensweise sicher und effizient ist.
Falsche Rückschlüsse aus amerikanischem Prüfbericht
Radio SRF berichtete in der Sendung «Echo der Zeit» vom 1. Juni 2022 und auf ihrer Webseite über den diesjährigen Prüfbericht des amerikanischen Rechnungshofes (GAO) zum Kampfflugzeug F-35A. Von der strengen Aufsicht des Rechnungshofes profitiert auch die Schweiz, da sie die F-35A über die amerikanische Regierung beschafft. Allerdings muss beachtet werden, dass viele der Aussagen des Prüfberichts im Zusammenhang mit dem Betrieb der aktuellen F-35 Flotte mit einer Vielzahl von Flugzeugen aus frühen Serien stehen. Die entsprechenden Punkte sind deshalb für die Schweiz nicht relevant beziehungsweise werden bis zur Einführung der F-35A in der Schweiz gelöst sein. Das GAO verweist darüber hinaus auch auf die vielen Programmfortschritte und hat keine neue Empfehlung ausgesprochen.
Im Bericht von Radio SRF werden jedoch aufgrund des Prüfberichtes und Aussagen der zuständigen Direktorin Rückschlüsse auf das Schweizer F-35A Programm gemacht, die aus erklärbaren Gründe falsch sind.
Das VBS veröffentlicht deshalb folgende Klarstellung:
1. Verfügbarkeit der Schweizer F-35A ist sichergestellt
Die Verfügbarkeitszahlen im Bericht des amerikanischen Rechnungshofes sind vor allem davon geprägt, dass die amerikanischen Streitkräfte einen Flottenmix mit vielen Flugzeugen aus frühen Serien betreiben, die nachgerüstet werden müssen. Dies wirkt sich nachtteilig auf die durchschnittliche Verfügbarkeit der Gesamtflotte aus. Die im Bericht des Rechnungshofes angegebenen Zahlen sind deshalb nicht repräsentativ für die zu erwartende Verfügbarkeit der Schweizer F-35A, die auf dem neusten Konfigurationsstand ausgeliefert werden.
Die US-Regierung verpflichtet sich, die Ersatzteilbewirtschaftung so zu steuern, dass eine Verfügbarkeit von mindestens 60% sichergestellt ist.
Zum Vergleich: Die Flottenverfügbarkeit der heutigen F/A-18C/D liegt aufgrund des fortgeschrittenen Lebenszyklus, der inzwischen kleinen Nutzerbasis und auch aufgrund der Massnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer teilweise deutlich unter 60% (siehe Medienmitteilung vom 2.4.2019, Verfügbarkeit der F/A-18-Flotte reduziert (admin.ch). Im Gegensatz dazu wird der F-35A durch eine grosse Anzahl Nutzerländer noch während Jahrzehnten betrieben, so dass die Schweiz auch gegen Ende des Lebenszyklus die geforderte Verfügbarkeit erreichen wird.
Darüber hinaus beschafft das VBS auch ein Logistikpaket, welches die Ersatzteilversorgung während mindestens 6 Monaten bei vollständig geschlossenen Grenzen sicherstellt. Dieses Logistikpaket stellt also sicher, dass die Verfügbarkeit auch dann gewährleistet ist, wenn der normale Austausch von Ersatzteilen zum Beispiel in einer ausserordentlichen Lage nicht mehr gewährleistet werden könnte.
2. Schweizer F-35A werden in Block 4 Konfiguration ausgeliefert
In den Schweizer Flugzeugen werden alle Block 4-Systemkomponenten eingebaut sein – das heisst, auch in den ersten Flugzeugen aus dem sogenannten Lot 19, die per 2027 ausgeliefert werden. Allfällige Software Updates im Rahmen des Block 4 würden gegebenenfalls in der Schweiz, ohne Kostenfolgen und ohne Auswirkung auf die Flottenverfügbarkeit eingeführt werden.
3. Verfügbarkeit der Triebwerke ist sichergestellt
Der Hintergrund, dass die Triebwerke zurzeit die angestrebte Verfügbarkeit nicht erreichen, liegt insbesondere darin, dass der Aufbau der Wartungskapazitäten der hohen Produktionsrate der Flugzeuge hinterherhinkt. Mehr Wartungsaufwand hat sich auch aufgrund übermässiger Abnutzung von Turbinenschaufeln in sandiger Umgebung ergeben, ein Problem, das inzwischen mit einer neuen Beschichtung gelöst wurde. Bis zum Zeitpunkt der Auslieferung der Schweizer Flugzeuge werden diese Punkte also gelöst sein. Zudem sind diese für die Schweiz ohnehin kein Anlass zur Sorge, denn die Instandhaltung der Schweizer Triebwerke soll durch die RUAG in der Schweiz erfolgen.
Die USA prüfen derzeit mögliche Umsetzungsvarianten zur Weiterentwicklung des Triebwerks. Einerseits werden punktuelle Verbesserungen am aktuellen Triebwerk vorgeschlagen, andererseits verlangt der amerikanische Kongress eine Studie für eine Strategie und einen möglichen Umsetzungsplan zum Einbau eines neuen Triebwerks. Die Kosten und der Nutzen dieser Varianten werden gegenwärtig geprüft. Ob eine oder mehrere dieser Umsetzungsvarianten weiterverfolgt werden, wird sich dann zeigen.
Dass ein modernes Kampfflugzeug Weiterentwicklungen erfährt, ist im Übrigen normal und zeigt sich auch beim Betrieb der heutigen F/A-18C/D, bei welchen im Verlauf der Nutzung mehrere Upgrades erfolgt sind.Der gesamte Artikel der Sonntagszeitung und die Folgeartikel der Tamedia Gruppe gehen von einer Berechnung aus, die von falschen Annahmen ausgeht und deshalb zu einer falschen Schlussfolgerung in Bezug auf den Stückpreis des F-35A führt.
Der Artikel der Sonntagszeitung führt (ohne eine Quelle zu benennen) aus, dass die US Air Force im laufenden Jahr «48 F-35A für 4.6 Milliarden Franken beschafft» und dass im Jahr 2023 «33 F-35A 3.9 Milliarden kosten werden». In der Annahme, dass sich der Journalist auf den Budgetentwurf 2023 des US-Verteidigungsdepartements bezieht, scheint er die jeweiligen Kostenblöcke durch die entsprechenden Stückzahlen zu teilen, womit er im Jahr 2022 auf 96 Millionen pro Stück und im Jahr 2023 auf 118 Millionen pro Stück kommt.
Diese Berechnung ist falsch: Die Budgets enthalten nicht nur die Kosten für Flugzeuge, sondern auch für zusätzliches Material oder Infrastrukturaufwände. Im Budgetentwurf 2023 wird darauf hingewiesen, dass im Bereich der Unterhaltskapazitäten ein Schwergewicht gebildet wird, um die Verfügbarkeit der F-35 weiter zu verbessern. Das bedeutet, dass im Jahr 2023 von der US Air Force mehr Mittel für zusätzliches Material beantragt werden als im Jahr 2022.
Dass die jeweiligen Kostenblöcke nicht nur aus Flugzeugen bestehen, lässt sich auch bei anderen Systemen im gleichen Dokument ablesen. So beantragt das US-Verteidigungsdepartement für das Jahr 2023 teilweise substantielle Beträge für Beschaffungen, obwohl keine zusätzlichen Systeme vorgesehen sind.
Der Artikel zeigt demnach nur, dass sich Kosteninformationen nicht vergleichen lassen – weder zwischen verschiedenen Staaten noch zwischen verschiedenen Jahren bei einem Staat.
Danach folgen Zitate, wonach «der F-35 auf jeden Fall teurer werden wird, als man uns weismachen will», dies unabhängig davon, wann das VBS den Beschaffungsvertrag unterschreibt, und «wir beim F-35 absolut keine Kostentransparenz haben». Ein Indiz dafür seien die allgemeinen Geschäftsbedingungen der USA, wonach es sich bei den Preisen um Schätzungen handle. Das ist falsch.
Fakt ist, dass die armasuisse mit der US-Regierung einen Vertragsartikel verhandelt hat, wonach die US-Regierung die F-35A beim Hersteller mittels eines Festpreisvertrages kauft, welcher auch die Inflation einpreist, und diese der Schweiz zum selben Festpreis weiterverkauft.
Darüber hinaus hat die armasuisse mit der US-Regierung vereinbart, dass sie Einblick in die sie betreffenden Stellen in den Beschaffungsverträgen zwischen der US-Regierung und dem Hersteller erhält. Damit verfügt die Schweiz einerseits über eine hohe Kostensicherheit und andererseits über eine hohe Kostentransparenz.
Die über 40-jährige Erfahrung der armasuisse bei der Abwicklung von Rüstungsgeschäften mit den USA hat zudem gezeigt, dass es in keinem der vielen Verträge zu Kostenüberschreitungen gekommen ist. Dies auch deshalb, weil die US-Regierung als gleichzeitiger Käufer und Verkäufer über eine rigide Kontrolle das Beschaffungsprojekt verfolgt.
Wenn die Schweiz den vorliegenden Vertrag bis Ende März 2023 jedoch nicht unterschreibt, muss er neu verhandelt werden und die Armee würde F-35A voraussichtlich aus späteren Produktionslots erhalten. Aufgrund auflaufender Teuerung kann schon nur aus diesem Grund nicht vom gleichen Beschaffungspreis ausgegangen werden.
Weiter führt der Tagesanzeiger aus, dass der CFO Kenneth Possenriede der Firma Lockheed Martin «unlängst» eingeräumt habe, dass der Preis des F-35 in Zukunft bescheiden ansteigen könne. Dazu ist zu sagen, dass Kenneth Possenriede diese Aussage am 26. Juli 2021 anlässlich einer Quartalskonferenz seiner Firma gemacht hat, seine Aussage ist also keineswegs eine Neuigkeit.In einem Artikel der WOZ vom 10. Februar 2022 werden verschiedene falsche Aussagen zum F-35A und dem betreffenden Beschaffungsprojekt gemacht.
Das Bundesamt für Rüstung armassuisse hält dazu fest:- Die Schlussfolgerung, dass es mit der Beschaffung des F-35A unweigerlich zu einer Annäherung an die NATO komme ist falsch.
Richtig ist, dass die Schweiz neutral und nicht Mitglied eines Verteidigungsbündnisses ist. Die Schweiz beteiligt sich seit 1996 an der Partnerschaft für den Frieden der Nato. Das VBS und der Bundesrat haben keine Absicht, sich darüber hinaus der Nato anzunähern. - Die Armee – und somit auch die Luftwaffe – ist so konzipiert, dass sie ihren Auftrag autonom ausüben kann. Dies gilt explizit auch für den Einsatz des neuen Kampfflugzeugs in allen Lagen. Gleichzeitig sollen unsere Systeme aber kompatibel mit den Systemen der Nachbarstaaten sein, um eine Kooperation zu ermöglichen, so wie das bereits heute mit dem F/A-18 CD der Fall ist.
- Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf die Schweiz fallen nämlich die Verpflichtungen eines neutralen Staates weg. In einem solchen Fall hätte die Schweiz das Recht, ihre Verteidigung in Zusammenarbeit mit anderen Staaten – einschliesslich ihrer Nachbarn, meist NATO-Mitglieder – zu organisieren, wenn dies als angemessen oder notwendig erachtet würde. Der Journalist schreibt, dass das VBS die Wiedererlangung der Luft-Boden-Fähigkeit nicht überzeugend darlege. Er hat in seiner Anfrage selbst den Bericht Luftverteidigung der Zukunft zitiert, in welchem alle Einsatzrollen beschrieben sind. Dazu hat das VBS den Journalisten auf ein konkretes Beispiel hingewiesen: «Damit [mit der Wiedereinführung der Luft-Boden-Fähigkeit] wird eine Abhaltewirkung gegen grenznahe bodengestützte Luftverteidigungssysteme mit grosser Reichweite des Gegners erreicht. Solche Systeme würden es der Schweiz nämlich verunmöglichen, den Schutz des Luftraums sicherzustellen. » Leider hat der Journalist den zweiten, erklärenden Satz in seinem Zitat weggelassen.
- Weiter gehört die Schweiz keinem Bündnis an und die Schweizer Armee ist eine reine Verteidigungsarmee: Die Luft-Boden-Fähigkeiten kommen also nur zum Einsatz, wenn diese letztendlich dem Schutz der eigenen Bevölkerung dienen. Deshalb ist die Beschreibung der WOZ von Einsätzen aus dem Syrienkrieg mit Bezug auf die Schweizer F-35A Beschaffung fragwürdig. Weiter heisst es, dass das VBS den Begriff Präzisionsmunition «beschönigend» verwendet. Fakt ist: Der Begriff wird international zur Abgrenzung von Freifallbomben verwendet, welche viel ungenauer eingesetzt wird als die mit GPS, Lasersignalen und Sensoren genau gesteuerte Präzisionsmunition.
- Die Darstellung, wonach das Evaluationsverfahren nicht überprüft werden kann, ist falsch. Die zuständigen parlamentarischen Organe erhalten, wo gefordert, Einsicht in die entsprechende Dokumentation. Die zitierte Darstellung der SRF-Sendung Rundschau, wonach die Schweizer Luftwaffe Präventivschläge plane, ist falsch. Dass völkerrechtswidrige Gewaltanwendungen im Sinne eines Präventivschlages für die Schweiz nicht in Frage kommen, hatte der Kommandant Luftwaffe in der Rundschau klargestellt.
In gleichen Artikel der WOZ wird der Historiker Peter Hug mit verschiedenen falschen Aussagen zum F-35A und dem betreffenden Beschaffungsprojekt des VBS zitiert. Das Bundesamt für Rüstung armasuisse hält dazu fest:
- Die Aussage von Peter Hug, dass der F-35A weniger für den Luftpolizeidienst und die Luftverteidigung als andere Kandidaten eigne, ist falsch. Richtig ist: Der F-35A ist als Mehrzweckflugzeug der 5. Generationdank seinen sehr guten Flugleistungen, Flugeigenschaften, vernetzten Sensorsystemen und Informationsüberlegenheit das für den Luftpolizeidienst und die Luftverteidigung am besten geeignete Kampfflugzeug. Die ersten beiden Eigenschaften werden bestens durch Flugvorführung an der Paris Airshow 2017 illustriert. Es ist völlig unglaubwürdig von Peter Hug, der sich vor nicht allzu langer Zeit noch für die Beschaffung von Trainingsflugzeugen für den Luftpolizeidienst einsetzte (siehe Rundschau am 30. Oktober 2019), die massiv besseren Flugleistungen des F-35A zu bemängeln.
- Der F-35A ist mit sehr guten Sensoren für die Erfassung und Identifikation von anderen Flugzeugen – bei Tag und bei Nacht – ausgestattet, was auch im Luftpolizeidienst ein grosser Vorteil ist. Zudem verfügt er über vorzügliche Flugeigenschaften für das Abfangen von schnellen wie auch langsameren Flugzeugen. Deshalb wird der F-35A bereits heute durch verschiedene europäische Luftwaffen für Luftpolizeidienstaufgaben eingesetzt. Er braucht nicht länger als die anderen Kandidaten, bis er startbereit ist. Der F-35A verfügt über ausgezeichnete Flugeigenschaften, insbesondere im Langsamflug, was für luftpolizeiliche Zwecke vorteilhaft ist.
Auch in der Luftverteidigungsrolle ist der F-35A dank seinen vernetzten Sensoren und seinen «Stealth»-Eigenschaften grundsätzlich jedem Kampfflugzeug der vierten Generation hochüberlegen. Der F-35A lässt sich mit Radar- und Infrarot-Sensoren nur schwer erfassen. Deshalb kann der Gegner nur schwer erkennen, ob und wie viele Flugzeuge im Luftraum sind und wo sie sich befinden. In Zeiten erhöhter Spannungen können den Entscheidungsträgern damit wertvolle Informationen geliefert werden, ohne sich selbst einer Gefahr auszusetzen (Identifikation und allenfalls Absicht des Flugobjektes). Während der Gegner das Kampfflugzeug auf seinem Bordradar vergeblich sucht, kann er selbst von den leistungsfähigen Sensoren der F-35A erfasst und mit Lenkwaffen bekämpft werden. Die sogenannten Stealth- sind deshalb auch in der Luftverteidigung ein entscheidender Vorteil. Dass es sich bei dieser Stealth-Fähigkeit bei einem Kampfflugzeug um eine entscheidende Fähigkeit handelt, lässt sich auch daran erkennen, dass verschiedene Nationen an neuen Kampfflugzeug-Projekten dieser Entwicklung folgen, darunter auch Projekte in Europa. - Die Vermutung von Peter Hug, dass die Luft-Boden-Fähigkeit höher als vom VBS angegeben gewichtet worden seien und damit der F-35A in der Evaluation bevorteilt gewesen sei, ist falsch. Richtig ist, dass die Luft-Boden-Fähigkeiten eine totale Gewichtung von 2.75% beträgt und die Evaluationskriterien ohne Kenntnis der Fähigkeiten der Kandidaten entwickelt wurden, welche ja bei der Offertanfrage noch gar nicht bekannt waren.
- Die Aussage von Peter Hug, dass der F-35A seine Fähigkeiten im autonomen Betrieb nicht ausspielen kann, ist falsch.
Richtig ist, dass die Schweiz den F-35A im autonomen Betrieb wirkungsvoll einsetzen kann, wie zum Beispiel auch die Erprobung in der Schweiz gezeigt hat. Bei seinem autonomen Einsatz ab dem Militärflugplätz Payerne hat der F-35A mit Abstand das beste Resultat aller Kandidaten im Bereich Wirksamkeit erreicht. - Falsch ist weiter die Aussage von Peter Hug zum Typenentscheid Finnlands zu Gunsten des F-35A: «Sie (Anm.: Finnland) gehen transparenter vor und erklären offen, dass die Wahl des F-35 dazu dient, sich verstärkt an die USA und die Nato anzulehnen und sich deren militärische Unterstützung zu sichern.» Damit suggeriert Peter Hug, dass sich Finnland mit dem Entscheid zu Gunsten des F-35A der Nato annähern will.
Das finnische Verteidigungsministerium sagt dazu jedoch folgendes: «Materialbeschaffungen für die finnischen Streitkräfte signalisieren keine Änderungen in der Ausrichtung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik Finnlands, sondern werden auf der Basis einer objektiven Kosten-Nutzen-Analyse gefällt. Das war auch beim Entscheid für die Beschaffung von F-35 der Fall.»
- Die Schlussfolgerung, dass es mit der Beschaffung des F-35A unweigerlich zu einer Annäherung an die NATO komme ist falsch.
In einem Artikel in den Tamedia-Zeitungen vom 24. Januar 2022 heisst es, die Armeeapotheke habe Hygienemasken der Firma Sichuan Zhengning Medical Instrument Co. «WS Protection, Love Is Power» von minderwertiger Qualität in den Umlauf gebracht. Diese seien durch das Bundesland Bayern wegen ungenügender Testresultate zurückgezogen worden und auch Tests im Labor Spiez seien ungenügend ausgefallen.
Dazu hält die Armee fest:- Die Armeeapotheke hat unmittelbar nach Kenntnisnahme des Rückrufes im Bundesland Bayern Kontakt mit Swissmedic (Schweizerische Zulassungs- und Kontrollbehörde für Heilmittel) aufgenommen. Swissmedic hat der Armeeapotheke bestätigt, dass für die Schweiz zu keinem Zeitpunkt Rückrufe oder Sicherheitsmitteilungen zu diesem Produkt publiziert worden sind. Abklärungen von Swissmedic haben ergeben, dass auch die deutsche Bundesbehörde BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) keine Kenntnis über einen landesweiten oder europaweiten Rückruf hat.
- Swissmedic hat die Abklärungen mit den zuständigen deutschen Bundesbehörden (unter anderen dem BfArM – Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und der zuständigen Bezirksregierung) noch vertieft. Am 19. Januar 2022 wurden von Seiten der deutschen Bundesbehörden der Swissmedic neue Informationen zugestellt. Diesen ist zu entnehmen, dass der Fall durch die zuständige Behörde in Deutschland behandelt wurde, und dass der EU Bevollmächtigte des Herstellers (Verbindungsstelle zwischen dem Hersteller und den zuständigen Behörden in Europa) am 24. Juni 2020 einen Prüfbericht eines Prüflabors vorweisen konnte, der belegt, dass die Hygienemaske ZHENGNING die Anforderungen der Norm EN-14683 für Typ-IIR-Masken erfüllt. Dieser Prüfbericht wurde von den deutschen Behörden als korrekt eingestuft.
- Zusätzlich wurde am 26. Juni 2020 durch den Lieferanten des Bundeslandes Bayern ein Testbericht betreffend des Differentialdruckes vorgelegt, welcher auch bestätigte, dass die Masken den vorgeschriebenen Differentialdruck für Typ-IIR-Masken einhalten.
- Auf Grund mehrerer positiver Prüfberichte sahen die lokalen deutschen Behörden keinen Grund, für das Produkt einen landesweiten und europaweiten Rückruf zu initiieren.
- Bei den Prüfungen im Labor Spiez handelt es sich, wie bereits mehrfach durch die Armee kommuniziert, lediglich um Vergleichsprüfungen. Diese wurden von der Armeeapotheke fallweise jeweils freiwillig in Auftrag gegeben, und gehören nicht zum ordentlichen Beschaffungsverfahren. Mit dieser Vergleichsprüfung wollte die Armeeapotheke ganz generell im Sinne einer Plausibilitätsprüfung sicherstellen, dass tatsächlich qualitativ mindestens genügende Medizinprodukte geliefert wurden, und nicht beispielsweise Produkte aus minderwertigen Materialien.
- Die Vergleichsprüfungen haben keine Aussagekraft bezüglich einer Normerfüllung oder der Qualität eines Produktes. Ist ein Produkt auf Grund dieser Vergleichsprüfung signifikant schlechter als ein Referenzprodukt, bedeutet dies nicht, dass die entsprechende Norm nicht erfüllt wird. Daher können bei diesen Vergleichsprüfungen auch keine Grenzwerte definiert werden, die die Tauglichkeit eines Produkts beschreiben.
2021
In einem Beitrag vom 26. November 2021 behauptet Radio SRF unter anderem, dass die Beschaffung von Lenkwaffen im Umfang von 400 Mio. Schweizer Franken in den Gesamtkosten für die Beschaffung des F-35A nicht enthalten seien. Diese Darstellung ist falsch, und der Journalist war im Vorfeld des Artikels mehrmals darauf hingewiesen worden. Das Bundesamt für Rüstung armasuisse stellt klar:
- Die Ersatzbeschaffung der Kurzstrecken-Lenkwaffen, die früher an das Ende ihrer Nutzungsdauer stossen, ist in den Beschaffungskosten enthalten. Die Nachbeschaffung der Mittelstrecken-Lenkwaffen wird erst in den 2040er-Jahren erfolgen, weshalb diese Kosten als eine Position der Gesamtkosten (Kosten für Beschaffung und Betrieb der Flotte über 30 Jahre) berücksichtigt wurden.
- Dieses Vorgehen stellte die Gleichbehandlung der Kandidaten sicher. In der Kosten-Nutzen-Analyse, die für den Zuschlag relevant war, wurden bei allen Anbietern exakt gleiche Stückzahlen bei der Luft-Luft-Bewaffnung berücksichtigt. Dies unabhängig davon, ob aufgrund der Weiterverwendung von vorhandenen Lenkwaffenbeständen eine Initialbeschaffung in grösserem oder kleinerem Umfang erfolgt. Die Evaluation hat gezeigt, dass der F-35A mit Abstand den höchsten Gesamtnutzen ausweist und gleichzeitig am günstigsten ist. Die anderen Kandidaten sind klar teurer als der F-35A.
- Ferner behauptet der Journalist, dass der F-35A nicht in den Finanzrahmen gemäss Planungsbeschluss passt, obwohl das Gegenteil der Fall ist. Diese Behauptung überrascht umso mehr, als dass der Artikel erschienen ist, nachdem das VBS gleichentags im Rahmen einer Medienkonferenz erklärt hat, dass sich der F-35A innerhalb der Vorgaben des Planungsbeschlusses befindet – und zwar sowohl ohne als auch mit Teuerung. Nach den heutigen Prognosen für die Inflation bis 2031 und den vorgesehenen Zahlungen beträgt das maximale Finanzvolumen 6,3 Milliarden Franken. Das mögliche Finanzvolumen wird somit unterschritten. Aktuell rechnet das VBS für die 36 Kampfflugzeuge des Typs F-35A mit einem Verpflichtungskredit von 6,035 Milliarden Franken.
- Der Artikel äussert sich zudem über die Meteor-Lenkwaffe, welche die europäischen Kandidaten angeboten haben. Dazu ist klarzustellen, dass das VBS die Flugzeuge umfassend und unter Berücksichtigung aller Aspekte evaluiert hat, einschliesslich ihrer individuellen Luft-Luft-Bewaffnung. Der grosse Vorsprung des F-35A bezüglich Gesamtnutzen ergibt sich daraus, dass der Kandidat in den drei Hauptkriterien Wirksamkeit, Produktesupport und Kooperation die höchste Bewertung erzielt, insbesondere im Hauptkriterium Wirksamkeit mit deutlichem Abstand. Im Bereich der Wirksamkeit ist der F-35A, als Kampfflugzeug der 5. Generation, dank seinem grossen technologischen Vorsprung, jedem Kampfflugzeug der Vorgängergeneration auch in Luftverteidigungsszenarien klar überlegen ist. Für die Beurteilung der Wirksamkeit müssen alle relevanten Eigenschaften wie Sensoren, Netzwerkfähigkeit, Bewaffnung und Erfassbarkeit durch gegnerische Sensoren in Betracht gezogen werden.
Damit lässt sich erkennen, dass der Artikel trotz einem intensiven Austausch mit dem SRF über die vergangenen Wochen auf vielen Behauptungen aufbaut.
Weiterführende Informationen:
In ihrem Artikel vom 11. November 2021 zitieren CH Media und angegliederte Zeitungen einen US-Senator, wonach der Hersteller des F-35 nicht die günstigste Offerte abgegeben haben soll. Zudem stellt Nationalrätin Franziska Roth die Integrität des Bundesrates in Frage. Das Bundesamt für Rüstung armasuisse stellt klar:
- Sowohl bei der Beschaffung als auch im Betrieb ist der F-35A das günstigste Angebot aller Kandidaten. Die Beschaffungskosten belaufen sich zum Zeitpunkt der Angebote im Februar 2021 auf 5,068 Milliarden Franken. Sie liegen damit klar im vorgegebenen Finanzvolumen von 6 Milliarden Franken, den die Stimmbevölkerung beschlossen hat. Auch wenn die Teuerung bis zum Zahlungszeitpunkt hinzugerechnet wird, liegen die Beschaffungskosten im Kreditrahmen. Eine externe Kanzlei hat dies in einer Plausibilitätsprüfung ebenfalls bestätigt.
- Die Gesamtkosten, welche aus den Beschaffungs- und den Betriebskosten bestehen, betragen beim F-35A über 30 Jahre gerechnet rund 15,5 Milliarden Franken. Der Unterschied zum zweitgünstigsten Kandidaten liegt bei rund 2 Milliarden Franken.
- Die armasuisse verfügt über verbindliche Angebote des US Staats. Dies betrifft sowohl die Beschaffungskosten wie auch die Betriebskosten für eine Laufzeit von zehn Betriebsjahren.
- Die Aussage von Nationalrätin Franziska Roth, wonach der F-35 die Serienreife nicht erreicht habe, ist falsch. Bereits heute sind weltweit über 720 F-35 ausgeliefert und im Einsatz. Mit diesen werden Luftpolizei- und Kampfeinsätze geflogen. Dereinst sollen über 3000 F-35 eingesetzt werden. Derzeit haben 13 Staaten, davon 7 in Europa das Kampfflugzeug bestellt.
- Die Evaluation hat gezeigt, dass der F-35A als Kampfflugzeug der fünften Generation einen grossen technologischen Vorsprung gegenüber den anderen Kandidaten aufweist: Er verfügt über neuartige, sehr leistungsfähige Sensoren. Diese sind untereinander umfassend vernetzt und die damit gewonnen Informationen werden der Pilotin oder dem Piloten übersichtlich dargestellt. Damit erreicht der F-35A Informationsüberlegenheit und ermöglicht den Besatzungen ein ausgezeichnetes Situationsbewusstsein. Zudem ist das Flugzeug so konstruiert, dass es nur schwer erfasst und bekämpft werden kann. Der Technologievorsprung des F-35A wird voraussichtlich sehr lange Bestand haben. Dies ist bei einer Nutzung über die 2060er-Jahre hinaus wichtig.
Weiterführende Informationen:
In ihrem Artikel vom 25. September 2021 schreiben La Liberté und angegliederte Zeitungen, armasuisse werde wichtige Daten aus dem Projekt «Neues Kampfflugzeug» vorzeitig den unterlegenen Kandidaten zurückgeben, bevor politische Diskussionen und allfällige Untersuchungen stattfinden können. Am 30. September 2021 wiederholte Radio SRF diese Darstellung. Sie ist falsch. Das Bundesamt für Rüstung armasuisse hält dazu fest:
- Das VBS wird die militärisch klassifizierten Daten nicht vor der Vertragsunterzeichnung für die Beschaffung des F-35A zurückgegeben, d.h. erst nach der parlamentarischen Beratung und nach einer möglichen Volksabstimmung.
- Zudem geht es dabei ausschliesslich um militärisch klassifizierte Daten. armasuisse muss diese Daten entsprechend den geltenden Informationsschutzabkommen mit den Herstellerländern oder der NATO behandeln und schützen. Dieses Abkommen besagt, dass militärisch klassifizierte Daten grundsätzlich nur für den vereinbarten Zweck verwendet werden dürfen – im vorliegenden Fall für die Evaluation und Beschaffung eines neuen Kampfflugzeuges. Deshalb ist das VBS verpflichtet, mit den Herstellerländern der unterlegenen Kandidaten zu klären, wie mit den militärisch klassifizierten Daten weiter verfahren werden soll.
- Alle anderen, nicht militärisch klassifizierten Akten und Daten der Kandidaten wie zum Beispiel die finanziellen Angebote sind von der Rückgabe nicht betroffen. Sie werden nach den geltenden Vorschriften und Grundsätzen aufbewahrt und archiviert. Das Gleiche gilt für alle weitere Akten und Daten, die im Rahmen der Evaluation für das neue Kampfflugzeug durch das VBS erstellt wurden.
- Die zuständigen parlamentarischen Delegationen und Kontrollorgane erhalten bis dahin jederzeit Einblick in die Daten, natürlich unter Beachtung der massgebenden Informationsschutzabkommen.
Weiterführende Informationen:
- Tages-Anzeiger, 30.9.2021: Unterlagen zum F-35-Kampfjetkauf – Amherd dementiert geplante Aktenvernichtung
- Dossier Air2030
In einem Beitrag vom 31. August 2021 stellt Radio SRF in der Sendung «Echo der Zeit» in Frage, dass die Offerte des US-Staats für den F-35A als neues Kampfflugzeug für die Schweiz verbindlich sei. Diese Darstellung ist falsch. Das Bundesamt für Rüstung armasuisse hält dazu fest:
- Die Offerte und die darin offerierten Zahlen sind verbindlich. Dies betrifft sowohl die Beschaffungskosten wie auch die offerierten Betriebskosten, bei welchen wir über eine Offerte mit einer Laufzeit von zehn Betriebsjahren verfügen.
- Das VBS beschafft die Flugzeuge via «Foreign Military Sales» (FMS) vom US-Staat zu denselben Konditionen, die er für sich selbst zur Anwendung bringt. Die Abwicklung des Rüstungsgeschäfts erfolgt formal über einen «Letter of Offer and Acceptance» (LOA).
- Der US-Staat wiederum wickelt die Beschaffung über eigene Verträge mit der US-Industrie ab. Bei den Verträgen zwischen dem US-Staat und der US-Industrie handelt es sich um Festpreisverträge, welche auch mittels einer strengen Aufsicht eingefordert werden. Die Schweizer Flugzeuge werden in den gleichen Verträgen aufgenommen, welche die US Flugzeuge oder die Flugzeuge von anderen F-35 Kunden enthalten.
- Die «Terms and Conditions» eines LOA sind für alle Rüstungsgeschäfte der USA identisch und gehen deshalb nicht auf Spezifika eines individuellen Rüstungsgeschäfts ein. Spezifika werden als Beilage zu einem LOA vereinbart. Zu diesen Spezifika gehört zum Beispiel, dass das VBS Einsicht in die oben erwähnten Festpreisverträge erhält.
- Zudem enthalten diese Festpreisverträge auch die Teuerung im Herstellerland.
- Auch in den Ausschreibungsunterlagen wurden verbindliche Preise verlangt. Alle Kandidaten haben die Ausschreibungsunterlagen anforderungsgemäss beantwortet.
- Nicht zuletzt hat sich bei der über 40-jährigen Erfahrung der armasuisse bei der Abwicklung von FMS-Geschäften gezeigt, dass es in keinem der vielen Verträge zu Kostenüberschreitungen gekommen ist. Dies auch deshalb, weil der US-Staat als gleichzeitiger Käufer und Verkäufer über eine rigide Kontrolle über die Kosten verfolgt.
Weiterführende Informationen:
In ihren Ausgaben vom 11. Juli 2021 berichteten der Sonntagsblick und die Sonntagszeitung über die Verbindlichkeit der Offerte für den F-35A als neues Kampfflugzeug. Zudem wurden in diesen Zeitungen wie auch am 9. Juli 2021 in den Tamedia-Zeitungen die Betriebskosten des Flugzeuges in den USA thematisiert.
Die Berichte enthalten einseitige Darstellungen. Das Bundesamt für Rüstung armasuisse hält dazu fest:- Die Offerten und die darin angebotenen Zahlen sind verbindlich. Dies betrifft sowohl die Beschaffungskosten wie auch die offerierten Betriebskosten, bei welchen wir über eine Offerte mit einer Laufzeit von zehn Betriebsjahren verfügen.
- Darüber hinaus gilt, dass die Preise zwischen verschiedenen Staaten nicht verglichen werden können, weil nicht klar ist, welche Kosten jeweils eingerechnet oder nicht eingerechnet sind.
- Das VBS beschafft die Flugzeuge via «Foreign Military Sales» (FMS) vom US-Staat zu denselben Konditionen, die er für sich selbst zur Anwendung bringt. Der US-Staat wiederum wickelt die Beschaffung über eigene Verträge mit den Firmen ab. In diesen Verträgen sind die Preise und die Vertragskonditionen verbindlich festgelegt und werden auch mittels einer strengen Aufsicht eingefordert. Käme es zu Kostenüberschreitungen, würde also der amerikanische Staat zu Gunsten der Schweiz beim Hersteller die Verbindlichkeit der Preise einfordern.
Wohl auch aufgrund dieser starken Käuferposition hat sich bei der über 40-jährigen Erfahrung der armasuisse bei der Abwicklung von FMS-Geschäften gezeigt, dass es in keinem der vielen Verträge zu Kostenüberschreitungen gekommen ist. Dies also deshalb, weil der US Staat als gleichzeitiger Käufer und Verkäufer über eine rigide Kontrolle über die Kosten verfolgt.
Darüber hinaus ist auch die Teuerung in den USA im Angebot eingerechnet. Dabei musste der Anbieter im Rahmen der Evaluation bekannt geben, welche Teuerungsannahmen eingerechnet wurden. Werden die Kosten zum Beispiel aufgrund einer tieferen effektiven Teuerung geringer, so wirkt sich das zu Gunsten der Schweiz aus
In der Ausgabe vom 29. Juni 2021 publizierten der Tagesanzeiger und weitere Zeitungen des Verlags Tamedia den Artikel «Für die F-35 müssten die Schweizer Flugplätze umgebaut werden».
Der Artikel enthält falsche Informationen. Auch andere Zeitungen und Online-Portale haben die falsche Informationen des Tagesanzeiger-Artikel übernommen.
Dazu hält das VBS fest:- Der Bundesrat wird in seiner Sitzung vom 30. Juni darüber diskutieren, welches neue Kampfflugzeug er beschaffen will, um die Schweiz auch in Zukunft vor Bedrohungen aus der Luft zu schützen.
- Im Rennen stehen neben dem im Artikel erwähnte F-35A (Lockheed Martin), auch die Flugzeuge Eurofighter (Airbus), Rafale (Dassault) und F/A-18 Super Hornet (Boeing).
- Die Kompatibilität der Flugzeuge mit der bestehenden Infrastruktur wurde in die Evaluation des neuen Kampfflugzeuges (NKF) miteinbezogen und analysiert.
- Die mit dem NKF verbundenen Immobilienkosten wurden im Rahmen der Evaluation analysiert.
- Im Artikel wird suggeriert, dass das VBS diese «Zusatzkosten irgendwo in den VBS- und Armeerechnungen verstecken» werden. Diese Aussage ist nachweislich falsch:
- Erforderliche Anpassungen bei den Immobilien werden im Rahmen der Armeebotschaft 2022 gleichzeitig mit der Beschaffung des NKF transparent aufgezeigt und wie immer im Parlament beantragt.
- Das VBS geht von Grössenordnung im Bereich der Immobilien von 100 Millionen Franken aus.
Zur Kommunikation der Association Patrouille des Glaciers vom 7. Mai 2021 nimmt das VBS wie folgt Stellung:
- Wir nehmen zur Kenntnis, dass die ASPdG die Zusammenarbeit sistiert hat und kündigen will, weil sie die Anforderungen des VBS an Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Kontrollen von Abrechnungen nicht erfüllen will.
- Die Arbeiten bei der Vorbereitung der PdG 2022 laufen plangemäss. Zu den Details der Austragung der PdG 2022 wird das VBS zu einem späteren Zeitpunkt informieren.
- Das VBS hat sich nie einer Diskussion verwehrt – im Gegenteil. Das VBS hat seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegenüber der AsPdG immer das Gespräch gesucht und trotz der schwierigen Situation innerhalb der AsPdG die Kommunikation aufrecht erhalten.
- So hat es auch nach dem Erhalt des Briefes Mitte April 2021 eine Sitzung einberufen, um eine Lösung zu finden. Das VBS hat der AsPdG dabei zugesichert, dass die Arbeiten für die Austragung der PDG 2022 weiterlaufen. Zudem wurde der Kommandant der Territorialdivision 1 als Ansprechperson bei Problemen für die AsPdG bestimmt. Dies damit alle offenen Fragen betreffend den Vorbereitungsarbeiten zeitverzugslos geklärt werden können. Somit erachtet das VBS die Forderung der AsPdG nach einem Schlichtungsmechanismus als erfüllt. Entsprechend erstaunt sind wir ob der Auslegung der Situation seitens der PdG.
- Das VBS wird bei den weiteren Arbeiten auch die Ergebnisse des abschliessenden KPMG-Berichtes und der laufenden Inspektion der Finanzkontrolle des Kantons Wallis berücksichtigen (siehe unten Klarstellung vom Februar 2021).
In einem offenen Brief, den Inside Paradeplatz am 17. März 2021 veröffentlicht hat, werden haltlose Anschuldigen im Zusammenhang mit dem F/A-18 erhoben und falsche Behauptungen verbreitet. Dazu hält das VBS fest:
- Das auf der Website der Luftwaffe publizierte Bild ist entgegen der Behauptung keine Fotomontage. Das Foto ist echt. Die Schweizer F/A-18 können in der auf dem Bild gezeigten Aussenlastkonfiguration (10 Radarlenkwaffen AIM-120, 2 Infrarotlenkwaffen AIM-9X) eingesetzt werden. Die notwendigen Pylon, Werfer und Lenkwaffen sind in der Schweiz vorhanden, die Flugzeuge können jederzeit damit ausgerüstet werden.
- Mit Schweizer F/A-18 wurden durch Schweizer Piloten bereits etliche Male Lenkwaffen aus Schweizer Beständen abgefeuert. Dies zum letzten Mal im Herbst 2018, anlässlich einem Verifikationsschiessen auf der Vidsel Test Range in Schweden (siehe Medienmitteilung vom 20.9.18).
- Falsch ist auch die Behauptung, das Fliegerschiessen Axalp habe abgesagt werden müssen, weil die Server in den USA ein Problem gehabt hätten. Richtig ist: Weil im Herbst 2019 anlässlich von Kontrollarbeiten an den Landeklappen der Schweizer F/A-18 Risse festgestellt wurden, mussten Einschränkungen für den Flugbetrieb erlassen werden. Dies hatte auch zur Folge, dass die Flugvorführung der Luftwaffe auf der Axalp abgesagt wurde (siehe Medienmitteilung vom 9.10.19). Diese Einschränkungen standen in keinem Zusammenhang mit Servern in den USA.
- Die Schweizer F/A-18 können jederzeit fliegen und benötigen keine «Erlaubnis» aus USA. Die Behauptung des Gegenteils im offenen Brief ist falsch.
- Zudem trifft auch nicht zu, Bundesrätin Amherd habe einen Brief des Autors «offensichtlich nicht erhalten». Richtig ist, dass der Brief Anfang Oktober eingetroffen war und der Eingang dem Autor im Namen der Bundesrätin bestätigt wurde.
Ab Februar 2021 berichteten Medien über die Zusammenarbeit zwischen VBS/Armee und der Association Patrouille des Glaciers. Dazu hält das VBS fest:
Die Patrouille des Glaciers (PdG)
- Die Patrouille des Glaciers (PdG) ist ein internationaler militärsportlicher Grossanlass gemäss der Verordnung über den Militärsport (siehe SR 512.38 - Verordnung vom 29. Oktober 2003 über den Militärsport). Der Anlass findet alle zwei Jahre statt, letztmals im April 2018. 2020 musste er wegen Covid-19 abgesagt werden. Neben Angehörigen der Schweizer Armee nehmen Militärpatrouillen aus rund 30 Ländern sowie zivile Patrouillen teil. 2018 beteiligten sich rund 1600 Dreierpatrouillen an diesem Skitouren-Wettkampf. Der Frauenanteil betrug rund 20 Prozent. Weitere Informationen finden sich unter Territorialdivision 1.
- Die Association PdG (ASPdG) unterstützt als Verein diesen Anlass. Sie besitzt die Markenrechte und ist zuständig für Marketing und Sponsoring. Die Zusammenarbeit zwischen VBS/Armee und ASPdG ist mit einer «Convention» geregelt.
Convention zwischen VBS/Armee und Association PdG
- Die Zusammenarbeit mit der ASPdG wurde 2018 überprüft und neu geregelt. In diese Arbeiten flossen die Handlungsempfehlungen aus einem Audit des VBS von Anfang 2017 ein. Daraus resultierte eine neue «Convention».
- Die «Convention» regelt unter anderem die Leistungen zwischen VBS und ASPdG und gibt dem VBS ein Einsichtsrecht in die Buchhaltung der ASPdG. Zu den Neuerungen gehört auch, dass die finanziellen Reserven der ASPdG begrenzt werden und dass das VBS neu die Teilnahmegebühren vereinnahmt und der ASPdG nur ausgewiesene Leistungen bezahlt. Diese Leistungen werden in einem Anhang detailliert ausgeführt.
- Die neue «Convention» gilt seit 1.1.2019 und regelt die Zusammenarbeit bei der Planung, Organisation, Durchführung und Finanzierung der Patrouille des Glaciers für die Wettkämpfe ab 2020. Im Jahr 2020 konnte aufgrund der Covid-19-Pandemie die Veranstaltung nicht stattfinden.
- Der Abschluss 2019/2020 ist ausstehend. Sobald dieser vorliegt, wird das VBS Einsicht in die Buchhaltung verlangen. Für die Jahre 2017/2018 hatte das VBS von der ASPdG den Rechnungsabschluss und den Revisorenbericht erhalten. Daraus waren keine Unregelmässigkeiten ersichtlich.
- Die ASPdG ist unabhängig vom VBS und entscheidet als Verein gemäss ihren Statuten eigenständig, wie hoch die Entschädigungen ausfallen. Das VBS kann durch das Einsichtsrecht eine transparente Ausweisung der Aufwände verlangen und nicht belegbare Aufwände kürzen.
Prüfung durch KPMG und Finanzkontrolle des Kantons Wallis
- Als im Herbst 2020 die ersten Vorwürfe zur internen Funktionsweise und zu Differenzen innerhalb der ASPdG bekannt wurden, hat das VBS die Zusammenarbeit suspendiert und gleichzeitig von der ASPdG eine unabhängige Klärung verlangt. Eine erste Zwischenbilanz des Wirtschaftsprüfungsunternehmens KPMG liegt nun vor.
Die KPMG hält fest, dass die ASPdG rechtmässig und konform mit ihren Statuten gehandelt hat.
Um die Planung für den Wettkampf 2022 sicherzustellen, wurde die Zusammenarbeit im Januar 2021 vorläufig wieder aufgenommen. - Die Zwischenbilanz der KPMG zeigt Handlungsbedarf auf, welcher von der ASPdG umgesetzt werden muss. Insbesondere sind Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Kontrollen von Abrechnungen zu verbessern. Die Umsetzung der Massnahmen und die Art und Weise der weiteren Zusammenarbeit werden in einer Arbeitsgruppe weiterverfolgt.
- Das VBS wartet auf den abschliessenden KPMG-Bericht sowie die laufende Inspektion der Finanzkontrolle des Kantons Wallis und behält sich allfällige Massnahmen vor.
In der Ausgabe vom 11. Januar 2021 publizierten der Tagesanzeiger und weitere Zeitungen des Verlags Tamedia den Artikel «Die Hightech-Drohne, die nicht fliegt». Der Artikel enthält einseitige Darstellungen und Behauptungen über die laufende Beschaffung des Aufklärungsdrohnensystems 15 (ADS 15).
Das Bundesamt für Rüstung hält dazu fest:- Bundesrätin Viola Amherd hat im Oktober 2020 die armasuisse beauftragt, der israelischen Herstellerfirma Elbit Systems Ltd. mitzuteilen, dass das VBS keine Mehrkosten übernehmen wird. Im Dezember 2020 hat sich armasuisse mit Elbit über das weitere Vorgehen zur Beschaffung und Lieferung der Hermes 900 HFE Drohne (ADS 15) geeinigt.
- Aus heutiger Sicht entstehen gegenüber den Vorgaben in der Rüstungsbotschaft 2015 keine Mehrkosten und das Projekt kann entsprechend finanziert werden. Wegen Kursschwank-ungen fallen Zusatzkosten von ca. 20 Millionen Franken an. Der Umgang mit Kursschwank-ungen ist in der Rüstungsbotschaft 2015 geregelt und wurde vom Parlament genehmigt. Für die Zertifizierung des De-Icing Systems wurde durch Nachverhandlungen mit dem Lieferanten eine Lösung gefunden, ohne dass dem Bund Mehrkosten entstehen.
Die Lieferung der Drohnen ist derzeit ab 2022 vorgesehen.
Zu einzelnen Aussagen im Artikel:
- Die ADS 15 mit der Immatrikulation D-11 kam im November 2019 in die Schweiz. Die Drohne wurde am 9. Dezember 2019 in Emmen den Medien vorgestellt und über die geplanten weiteren Schritte wurde informiert. Der Zweck der Stationierung in Emmen war, die Integration in die Schweizer Infrastruktur zu überprüfen und die Ausbildung für das Berufspersonal zu beginnen. Diese Aktivitäten mussten im März 2020 wegen COVID-19 unterbrochen werden und konnten bis heute noch nicht abgeschlossen werden.
- Der Artikel behauptet, die Drohne sei heimlich zerlegt und nach Israel zurückgebracht worden. Richtig ist: Nach dem Absturz der Drohne D-13 am 5. August 2020 in Israel wurde nach Absprache mit dem Hersteller die in Emmen stationierte Drohne nach Israel transportiert. Die Drohne sollte bei den anstehenden Arbeiten des Lieferanten den Verlust der abgestürzten Drohne überbrücken, damit sich die Auslieferung nicht weiter verzögert.
- Zur Aussage, es sei «unklar, wann – und ob überhaupt – die D-11 wieder in die Schweiz zurückkehren wird»: Die Aussage ist falsch. Es kann lediglich noch nicht gesagt werden, wann ein Erstflug der ADS 15 (oder der Drohne D-11) in der Schweiz stattfinden wird.
- Weiter wird von «unabsehbarer Schaden für die Bundeskasse» gesprochen. Richtig ist: Das Projekt ADS 15 kann aus heutiger Sicht gemäss den Vorgaben der Rüstungsbotschaft 2015 finanziert werden. Die durch den Bund bis dato geleisteten Zahlungen könnten im Falle eines Abbruchs der Beschaffung vom Lieferanten zurückgefordert werden. Entsprechende Garantien von Elbit liegen vor.
- Die Aussage «dass der Schweizer Rüstungskonzern RUAG ein solches System gemeinsam mit Partnern in den Niederlanden und Israel entwickelt» ist irreführend. Es war nie vorgesehen, dass RUAG oder Elbit den Radar für Sense and Avoid entwickelt oder armasuisse einen Radar-Entwicklungsvertrag mit einem Unterlieferanten von Elbit abschliesst. Der Entwicklungsvertrag für den Radar, respektive der dazu notwendige Technologietransfer, war zwischen Elbit und dem holländischen Lieferanten vorgesehen. Die Zusammenarbeit des holländischen Lieferanten mit Elbit bestand seit Mitte 2014 und es gab für armasuisse keinen Grund, die in Meetings gemachten Angaben betreffend Exportlizenz der Radartechnologe in Frage zu stellen. Nach gut zwei Jahren Zusammenarbeit kam der Entscheid der holländischen Regierung im April 2016, den Export der Radartechnologie nicht zu bewilligen, für alle Beteiligten sehr überraschend.
Dem Bund entstehen durch den Lieferantenwechsel des Radars und der anstehenden Zertifizierung keine Mehrkosten.
In ihrer Ausgabe vom 10. Januar 2021 publizierte die NZZ am Sonntag den Artikel «Der Verteidigungsattaché und sein Wagenpark». Der Artikel enthält falsche Behauptungen über die Nutzung der Dienstfahrzeuge auf der Schweizer Botschaft in Washington (USA). Das Bundesamt für Rüstung armasuisse hält dazu fest:
- Der Verteidigungsattaché in Washington unterhält keinen Wagenpark. Richtig ist: Die Dienstfahrzeuge werden von der armasuisse verwaltet. Die Fahrzeuge wurden für VBS-Mitarbeitende angeschafft, die an Lehrgängen der amerikanischen Streitkräfte teilnehmen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden mit einer Ausnahme diese Lehrgänge abgesagt. Die Fahrzeuge, die im Freien auf dem Botschaftsgelände stehen, wurden und werden für längere Zeit nicht genutzt. Aus diesem Grund wurden sie für die Nutzung durch andere Mitarbeitende des VBS zu privaten Zwecken, aber gegen Vergütung der Fahrmeilen, zur Verfügung gestellt.
- Ebenso haltlos ist die geäusserte Kritik, es sei unverständlich, weshalb dem mit 1,7 Stellen dotierten armasuisse-Büro acht Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Richtig ist: armasuisse verwaltet aktuell acht Fahrzeuge, um sie den erwähnten Lehrgangsteilnehmern zur Verfügung zu stellen. Bei Verfügbarkeit werden sie auch durch die VBS-Mitarbeitenden auf der Botschaft genutzt. Bei Privatfahrten wird eine Meilenpauschale verlangt und es müssen Benzin, Garagierung, Reinigung sowie allfällige Kleinreparaturen privat bezahlt werden.
- Der Artikel behauptet, es gebe Unstimmigkeiten wegen einer Prüfung der internen Revision VBS im Jahr 2014. Richtig ist: Aufgrund der damaligen Empfehlungen wurden verschiedene Alternativen evaluiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Ankauf von Neuwagen, deren mehrjährige Nutzung und später ein Weiterverkauf die kostengünstigste Variante ist. Die Kosten für die Dienstwagen betragen jährlich rund 30'000 Franken.
2020
Verschiedene Medien berichten seit dem 22.12.20 über ein Rechtsverfahren im Zusammenhang mit der Beschaffung von Masken. Die Artikel enthalten Behauptungen und falsche Fakten. Dazu hält die Armeeapotheke fest:
- Das erwähnte Unternehmen hat ein Rechtsverfahren gegen die Armee angestrengt. Es bestehen unterschiedliche Ansichten zwischen der Armee und der Firma. Diese sind Gegenstand von laufenden Verhandlungen zu einer Lösungsfindung. Das Ergebnis und allfällige weitere Schritte können nicht vorweggenommen werden.
- Um die Versorgung des Gesundheitswesens sicherzustellen, hat die Armeeapotheke im Frühling 2020 so viele Schutzmasken beschafft, wie es auf dem Markt möglich war und sofern die Produkte in genügender Menge, mit der erforderlichen Qualität und preislich innerhalb der Vorgaben des BAG und der genehmigten Kredite verfügbar waren. Die erwähnte Firma konnte aufgrund von Problemen mit ihrer Bank zum vereinbarten Zeitpunkt am 17. April 2020 jedoch nicht liefern; die vorgesehene Beschaffung stand zu jenem Zeitpunkt zudem noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung der Qualitätsanforderungen. Die Armee hatte ihren Teil des Geschäftes mit einer Anzahlung bereits erfüllt. Diese Anzahlung wurde von der Firma am 20. April 2020 zurückerstattet und damit das Geschäft rückabgewickelt.
- Die Armeeapotheke und die Task Force Beschaffungskoordination waren nicht an der Strafuntersuchung wegen Geldwäscherei gegen die Firma beteiligt und haben diese auch nicht ausgelöst. Diese wurde unabhängig von einer kantonalen Staatsanwaltschaft angehoben und durchgeführt.
- Entsprechend hat das VBS auch keine Kenntnisse über die Hintergründe dieses Verfahrens. Das VBS wurde am 28. April 2020 durch den Staatsanwalt um den Beizug der Akten und um einen amtlichen Bericht gebeten. Erst damit wurde das VBS offiziell über die Strafuntersuchung informiert. Das VBS hat vorher weder eine Anzeige noch eine Meldung wegen Geldwäscherei vorgenommen.
- Falsch ist auch die Behauptung, es habe einen Machtkampf im Zusammenhang mit der neuen Unterstellung der Armeeapotheke unter die Logistikbasis der Armee (LBA) gegeben.
Richtig ist: Die Neuunterstellung der Armeeapotheke war seit einiger Zeit mit den verschiedenen involvierten Stellen diskutiert worden. Aufgrund der aktuellen Lage wurde dieser Prozess beschleunigt und die Neuunterstellung wurde am 18. Mai 2020 vollzogen (siehe Medienmitteilung). Dies wurde notwendig, um die zusätzlichen Logistikaufgaben sicherzustellen, damit die Armeeapotheke ihre Funktionsfähigkeit behält und sie in der Corona-Krise ihre neuen Aufgaben zugunsten der Schweizerischen Bevölkerung sicherstellen kann. Die Armeeapotheke hat ihr Beschaffungsvolumen vervielfacht und damit ist auch das Volumen der Bewirtschaftung und Verteilung von medizinischen Gütern gestiegen. Ziel ist es, dass die Armeeapotheke in der Krise und auch künftig die gewünschten Leistungen zur richtigen Zeit am richtigen Ort erbringen kann. Für diese Aufgabe ist die LBA mit ihren etablierten Prozessen die beste Partnerin.
Siehe dazu auch die Antwort des Bundesrates auf die Interpellation 20.4069.Die Berichterstattung der Aargauer Zeitung und weiterer Publikationen von CH Media vom 7.12.2020 enthält falsche Angaben. Dazu hält das VBS fest:
- Im Artikel wird behauptet, «die für die Versorgung der Bevölkerung zuständige Armee» habe «praktisch keine Reserven» gehabt. Richtig ist: Die Armeeapotheke war und ist nicht für Versorgung der Bevölkerung mit Masken und weiteren Schutzgütern zuständig. Erst im Zuge der Corona-Krise am 21. März 2020 hat die Armeeapotheke vom Bundesrat die Aufgabe erhalten, wichtige medizinische Güter zu beschaffen – um die Versorgung des Gesundheitswesens sicherzustellen. Für die Pflichtbevorratung waren andere Stellen der Bundesverwaltung und die Kantone zuständig.
- Es stimmt nicht, dass Anbieter nicht zur Armeeapotheke durchgedrungen seien. Die Armeeapotheke erhielt auf dem Höhepunkt der Krise mehrere hundert Angebote täglich. Die meisten Angebote waren unstrukturiert und ohne die notwendigen Detailangaben. Die Absender erhielten darauf eine standardisierte E-Mail mit einem Fragebogen. Erst, wenn sie die erforderlichen Informationen eingereicht hatten, erfolgte eine weitere Prüfung. Viele Angebote erfüllten jedoch die Anforderungen bezüglich Grossmengen, Qualitätsanforderungen oder Liefergeschwindigkeit nicht, oder es wurden keine Unterlagen zur Prüfung eingereicht. Zu diesem Zeitpunkt wurden zudem nur Angebote berücksichtigt, die rasch Masken in der Schweiz liefern konnten. Es gab sehr viele Anbieter, die Masken in China beschaffen wollten oder bereits beschafft haben, jedoch keine Transporte in die Schweiz hatten.
- Die im Artikel erwähnten Zuschläge an eine bestimmte Firma erfolgten zu einem Zeitpunkt, da die Versorgung mit Schutzmasken nicht sichergestellt war. Der Anbieter war in der Lage, in kurzer Zeit genügende Mengen zu liefern, weshalb die Armeeapotheke hohe Preise in Kauf nehmen musste. Die Beschaffungsvorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) vom 21.03.2020 umfassten 1.8 Mio. FFP2 Masken zu einem maximalen Stückpreis von CHF 10 und zusätzlich am 4.4.2020 75 Mio. Masken zu einem maximalen Stückpreis von CHF 8. Die Bestellungen bei der betroffenen Firma erfolgten am 2.3.2020, am 17.3.2020 und letztmals am 24.3.2020. Im Februar wurden Masken bei anderen Herstellen bereits zu Preisen von CHF 7.48 bis 8.30 eingekauft. Für die betroffene Firma hat das Bayrische Gesundheitsministerium am 25.3.2020 einen Vergabezuschlag für einen Vertrag vom 3.3.2020 über den Kauf von 1 Mio. Masken zum Stückpreis von EUR 8.90 publiziert.
- Falsch ist schliesslich auch die Behauptung, Brigadier Markus Näf habe als Beschaffungskoordinator im Geschäft mit der ewähnten Firma eine treibende Rolle gespielt. Als er am 23.3.2020 seine Tätigkeit aufgenommen und am 26.3.20 formell eingesetzt wurde, waren die ersten Beschaffungen bei dieser Firma bereits beschlossen und eine weitere stand kurz vor dem Abschluss. Brigadier Näf konnte keinen Einfluss auf diese Verträge nehmen.
Die Berichterstattung zu den neuen Kampfjets im Tages-Anzeiger vom 21.11.2020 betreffend der Abhängigkeiten von den Herstellerländern ist irreführend. Der Leiter des Kompetenzbereiches Luftfahrtsysteme armasuisse wird zitiert, dass «alle vier Kandidaten im Bereich der operationellen Fähigkeit gleichwertig abhängig von den USA sind». Dabei lässt die Berichterstattung aus, worauf sich diese Aussage explizit bezieht, nämlich auf die Fähigkeiten im Bereich der Interoperabilität. Nachfolgend das Zitat in seiner Vollständigkeit wiedergegeben:
Abhängigkeit von den USA
Alle Kandidaten sind im Bereich der operationellen Fähigkeiten gleichwertig abhängig von den USA d.h. in der Kommunikation mit Link16, Identifikation mit Mode 4/5 und Navigation mit GPS P-Code.
Im Bereich der sicheren Sprach- und Datenkommunikation verwenden alle westlichen Kampfflugzeuge amerikanische Standards, weil die USA hier technologisch führend sind. Deshalb ermöglichen nur diese Standards den sicheren Informationsaustausch mit anderen Streitkräften. Sie werden auf den Schweizer F/A-18 C/D wie auch bei allen NKF-Kandidaten eingesetzt.Im Anschluss an die Abstimmung vom 27. September 2020 berichteten verschiedene Medien, dass das VBS im Vorfeld der Abstimmung nicht transparent über die Einsätze gegen Bodenziele resp. über die angebliche Anschaffung von Freifallbomben berichtet habe. Die Darstellung ist falsch.
Richtig ist, dass das VBS im Abstimmungsbüchlein, in Referaten sowie in verschiedenen offiziellen Grundlagendokumenten an das Parlament und auch in anderen Dokumenten wie zum Beispiel im Bericht der Expertengruppe Neues Kampfflugzeug «Luftverteidigung der Zukunft» oder in der Broschüre Air2030 darauf hingewiesen hat.
Diese Dokumente sind im Webdossier Air2030 frei verfügbar und für jedermann zugänglich. Von Intransparenz kann daher keine Rede sein.Um was geht es bei Einsätzen gegen Bodenziele?
Die Schweizer Luftwaffe verfügt seit der Ausserdienststellung des Hunters im Jahr 1994 nicht mehr über die Fähigkeit Bodenziele aus der Luft und aus grosser Distanz bekämpfen zu können. Mit der Beschaffung einer geringen Menge von moderner Luft-Boden-Munition und den dazugehörenden Aufklärungsmitteln (am Flugzeug angebracht) soll wieder eine beschränkte Fähigkeit aufgebaut werden. Es geht somit – wie mehrfach festgehalten – nicht um eine vollausgebaute Fähigkeit mit Beschaffung und Bevorratung grosser Mengen an Kriegsmunition.
Bei den für den Aufbau vorgesehenen Munition handelt es sich nicht um «Freifallbomben», sondern um Präzisionsmunition, die gegen wichtige gegnerische Ziele am Boden eingesetzt werden könnte. Der Einsatz solcher Munition würde im Verteidigungsfall erfolgen, wenn keine anderen Mittel die gleiche Wirkung erzielen könnten.
Im Rahmen der Evaluation wird die zu beschaffende Munition gemäss Artikel 11 der Verordnung des VBS über die Beschaffung, die Nutzung und die Ausserdienststellung von Material auf ihre völkerrechtliche Konformität geprüft und entsprechend in der Armeebotschaft ausgewiesen.
Grundlage der Berichterstattung zu den angeblichen Freifallbomben ist die Veröffentlichung einer Mitteilung der DSCA (Defense Security Cooperation Agency) vom 30. September 2020. Die in dieser Mitteilung aufgeführten Systeme und Güter beziehen sich auf die Anforderungen, die das VBS im Rahmen der Beschaffung eines neuen Kampfflugzeuges im März 2018 bekanntgegeben hat.
Die sogenannte 36(b) Kongressbenachrichtigung und die dazugehörige DSCA-Medienmitteilung sind ein erforderlicher Teil des US-Rechts vor der Zustellung eines Angebots an potenzielle ausländische Partner. Die Kongressbenachrichtigung legt die maximale Menge an Verteidigungsausrüstung und den maximalen Dollarbetrag fest, welchen die USA einem Partner anbieten. Es handelt sich aber hierbei nicht um eine Offerte.Quellen:
2020
Abstimmungsbüchlein
In den «Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 27. September 2020» steht: «Mit Kampfflugzeugen werden zudem Aufklärungsflüge durchgeführt und Einsätze gegen feindliche Ziele am Boden geflogen. Ohne Schutz des Luftraums kann die Armee ihre Truppen auch am Boden nicht wirksam einsetzen. »2019
Medienkonferenz Bundesmedienzentrum, 8. April 2019
Hinweis zu den Aufgaben der Luftwaffe sowie Erläuterung zu den Missionen während der Evaluation.Botschaft zu einem Planungsbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge
Kapitel 3.3.1. «um im Fall eines bewaffneten Konflikts Bodenziele des Gegners (zum Beispiel Artillerie, Lenkwaffenstellungen, am Boden abgestellte Kampfhelikopter) zu bekämpfen und damit die eigenen Bodentruppen zu unterstützen».Anforderungen des VBS an die Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs (NKF) und eines neuen Systems der bodengestützten Luftverteidigung grösserer Reichweite (Bodluv GR)
Verabschiedung des Planungsbeschlusses über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge durch das Parlament, 20. Dezember 2019.2017
Der Vollständigkeitshalber sei darauf hingewiesen, dass bereits in der Beratung des Rüstungsprogramm 2017 darauf hingewiesen wurde, dass mit dem Projekt «Neues Kampfflugzeug» die Erdkampffähigkeit wieder ermöglicht werden soll. Der Nationalrat lehnte damals einen in der Sicherheitskommission aufgebrachten Antrag ab, die Fähigkeit «Erdkampffähigkeit» bereits auf dem F/A-18C/D weitereinzuführen.Am 10.8.20 publizierten der Tages-Anzeiger und weitere Zeitungen des Tamedia-Verlags den Artikel «Wie die USA Schweizer Waffen kontrollieren». Dazu hält das VBS fest:
- Im Artikel wird behauptet, dass die USA bestimmen, ob die Schweizer F/A-18 geflogen und ob sie ihre Lenkwaffen abschiessen können. Das ist falsch. Die Schweiz kann die von den USA gekauften Waffen unabhängig und souverän in allen Lagen verwenden. Im Luftpolizeidienst z.B. fliegen die F/A-18 der Luftwaffe seit Jahren mit Lenkwaffen, ohne Involvierung der USA.
Es finden Inspektionen der Schweizer F/A-18 und ihrer Waffensysteme mit den USA statt, dabei geht es aber nicht darum, den Einsatz dieser Waffen zu kontrollieren. Es geht den USA darum, dass sie nach dem Verkauf von Waffensystemen sicherstellen wollen, dass diese nicht widerrechtlich an Dritte weitergegeben werden. Das liegt auch im Interesse der Schweiz, die sich selber international stark in diesem Bereich engagiert: Waffen sollen nicht unkontrolliert in Umlauf gebracht und verbreitet werden. Deshalb lagert auch das VBS seine Waffensysteme immer mit gleich grosser Sorgfalt, mit oder ohne US-Inspektionen.
Ebenfalls im Sinne der Exportkontrolle regelt der amerikanische Staat, welche Waffensysteme an welche Länder verkauft werden. Das ist nichts Ungewöhnliches, auch die Schweiz betreibt Waffenausfuhrkontrollen, genauso wie viele andere Staaten ebenfalls. Auf die Evaluation eines neuen Kampfflugzeugs hat das keinen Einfluss, da alle Kandidaten verbindliche Offerten einreichen müssen, aus denen klar hervorgeht, was die Schweiz bei welchem Kandidat bekommen würde bei einem Zuschlag. - Falsch ist weiter die Behauptung, dass die Piloten der Schweizer Luftwaffe nicht wissen, ob ihre Lenkwaffen im Ernstfall treffen. Die Zuverlässigkeit der Schweizer Lenkwaffen wird in regelmässigen Testschiessen bestätigt. Dabei bestimmt alleine das VBS, welche Waffen zu Testzwecken verwendet werden.
Grundsätzlich gilt für das VBS, wie bereits früher kommuniziert: Die Schweiz strebt möglichst viel Autonomie an. Eine vollständige Unabhängigkeit vom Herstellerunternehmen und -land ist nicht möglich. Der Betrieb technologisch hochentwickelter, aus dem Ausland beschaffter Systeme hat Abhängigkeiten zur Folge. Das gilt für die Beschaffung bei jedem Hersteller und betrifft nicht nur die Schweiz, sondern alle Staaten, die Kampfflugzeuge und ihre Systeme nicht vollständig selber herstellen.
Technologische Abhängigkeiten sind aber Prüfpunkte, die im Rahmen der Evaluation sorgfältig ermittelt und als Risiken ausgewiesen werden. Dabei wird auch analysiert, wie sich Abhängigkeiten reduzieren lassen und wie gross der Aufwand dafür wäre.Weiterführende Informationen:
- Im Artikel wird behauptet, dass die USA bestimmen, ob die Schweizer F/A-18 geflogen und ob sie ihre Lenkwaffen abschiessen können. Das ist falsch. Die Schweiz kann die von den USA gekauften Waffen unabhängig und souverän in allen Lagen verwenden. Im Luftpolizeidienst z.B. fliegen die F/A-18 der Luftwaffe seit Jahren mit Lenkwaffen, ohne Involvierung der USA.
Am 4.8.20 publizierte Bluewin.ch den Artikel «Warum Kampfjets nie ganz der Schweiz gehören werden» Er enthält falsche Behauptungen und ungenaue Aussagen von verschiedenen Personen. Dazu hält das VBS fest:
- Aussage von Nationalrätin Priska Seiler Graf: «Die USA können unsere Jets auf Knopfdruck vom Himmel holen. Oder uns nicht starten lassen, wenn sie es nicht wollen.»
Richtig ist: Eine Fernsteuerung durch Eingriffe in die Elektronik ist nicht möglich, weder bei den F-5 Tiger und F/A-18C/D noch bei einem neu zu beschaffenden Kampfflugzeug. - Aussage von alt Nationalrat Boris Banga zum ersten Absturz einer F/A-18 in der Schweiz (7. April 1998 im Wallis): «Da kamen die Amerikaner zuerst und ohne Schweizer Vertreter, um zu schauen, was das Problem war. Und dabei haben sie Daten abgesaugt.»
Richtig ist, dass die Firma Boeing auf Anfrage des VBS und im Beisein eines Schweizer Vertreters den Flugdatenschreiber in den USA ausgelesen hat. Dies deshalb, weil die Schweiz damals die entsprechende Ausrüstung in der Einführungsphase des F/A-18 noch nicht selbst besass. - Aussage des Präsidenten der Gruppe Giardino, Willy Vollenweider: «Da werden die Schweizer Techniker weggeschickt, wenn die Techniker des Lieferanten in Schweizer Werkstätten Updates an der Avionik vornehmen.»
Richtig ist: Updates der Avionik in Schweizer Werkstätten werden durch Schweizer Techniker eingebaut, bei Bedarf mit Unterstützung des Lieferanten. Die Schweizer Techniker werden nicht weggeschickt.
Weiterführende Informationen:
- Aussage von Nationalrätin Priska Seiler Graf: «Die USA können unsere Jets auf Knopfdruck vom Himmel holen. Oder uns nicht starten lassen, wenn sie es nicht wollen.»
2019
Am 4.10.19 hat Blick online über eine Reise des neuen Chefs der Armee, Divisionär Thomas Süssli, nach Israel berichtet. Dazu hält das VBS fest:
- Thomas Süssli hat Ende Juli/Anfang August 2019 private Familienferien auf eigene Kosten im Nahen Osten verbracht, begleitet von seiner Gattin und seiner Tochter. Die Familie Süssli übernachtete für eine Nacht in Haifa (Israel). Auf seiner Reise gab es ein privates Treffen mit einem ehemaligen Mitglied des Cyber-Kommandos der israelischen Streitkräfte. Die beiden hatten sich im Frühjahr an einem Seminar zum Thema Cyber-Sicherheit in der Schweiz kennen gelernt.
- Bei der Firma Elbit war der designierte Chef der Armee noch nie. Zudem ist er als heutiger Chef FUB (Führungsunterstützungsbasis) nicht in den Beschaffungsprozess für den Ersatz von mobilen Kommunikationsmitteln involviert. Er ist weder im Projektausschuss noch hat er Zugriff auf oder Einsicht in die Dokumente.
In ihrer Ausgabe vom 13. Juli 2019 berichtet die «Schweiz am Wochenende» über die Entsorgung von Munition bei der Schweizer Armee. Unter anderem heisst es, dass die Armee in den nächsten 15 Jahren die Hälfte ihres Munitionsbestandes verschrottet und jedes zweite Geschoss ungebraucht entsorgt wird. Richtig ist: In den nächsten fünfzehn Jahren muss aus Haltbarkeits- und Sicherheitsgründen etwa die Hälfte des aktuellen Munitionsbestandes entsorgt werden, sofern die Munition bis dahin nicht verbraucht wird. Es wird jedoch nur ein kleiner Teil der Einsatzmunition nicht verbraucht. Die gesamte Übungsmunition und ein grosser Teil der Einsatzmunition wird verschossen.
Weiter heisst es, dass die Verschrottung jährliche Kosten von über 10 Mio. Franken verursacht. Richtig ist: Vom Rahmenkredit der Armeebotschaft 2019 werden für die Munitionsentsorgung 1,3 Mio. Franken verwendet.
Zudem hält das VBS ganz allgemein fest, dass drei Möglichkeiten bestehen, um Munition zu entsorgen: Vernichtung, Recycling oder Verkauf. Letzteres ist allerdings nicht möglich, wenn die Munition aus Alters- oder Sicherheitsgründen entsorgt werden muss. Welche Form der Entsorgung zur Anwendung kommt, ist abhängig von Sicherheitsaspekten, der Wirtschaftlichkeit und der Munitionssorte selbst.In ihrer Ausgabe vom 23. Mai 2019 berichtet die Wochenzeitung (WOZ), dass der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) demokratische Linke überwache. Der NDB hält dazu fest:
Der NDB überwacht keine der bezeichneten Organisationen oder andere politische Gruppierungen und Parteien. Gewisse Personen oder Organisationen können aber in Dokumenten erscheinen, die beim NDB abgelegt sind. Dabei muss das Dokument als Ganzes einen Aufgabenbezug nach Art. 6 Abs. 1 Nachrichtendienstgesetz aufweisen (Gewaltextremismus, Terrorismus, Spionage, Proliferation, Angriffe auf kritische Infrastrukturen, sicherheitspolitisch bedeutsame Vorgänge im Ausland). Der NDB darf beispielsweise Informationen sowohl über unbewilligte als auch über bewilligte Kundgebungen bearbeiten, sofern dabei Gewalt ausgeübt oder zu Gewalt aufgerufen worden ist. Auch Dokumente aus öffentlichen Quellen (sogenannte Open Source Intelligence oder OSINT) darf der NDB in seinen Systemen speichern, wenn ein Aufgabenbezug wie oben erwähnt besteht. So können mit einer Volltextsuche unter Umständen Namen von Personen auffindbar sein, die kein Ziel der Beschaffungsaktivitäten des NDB sind und keine Gefährdung der inneren Sicherheit darstellen. Dies wird bei der Antwort auf ein Einsichtsgesuch entsprechend ausgewiesen.
Der NDB hält die gesetzlichen Vorgaben und das Verbot der Informationsbearbeitung über politische Betätigung strikt ein. Dies bestätigen auch die Kontrollen der Aufsichtsbehörden (Geschäftsprüfungsdelegation, unabhängige Aufsichtsbehörde) und – im Rahmen von Verwaltungsverfahren von gesuchstellenden Personen und Organisationen – der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) sowie das Bundesverwaltungsgericht.
In einigen begründeten Fällen ist es dem NDB möglich, die Antwort auf eingegangene Auskunftsgesuche aufzuschieben (Art. 63 Abs. 2 NDG). Dieser Entscheid kann jeder Gesuchsteller durch den EDÖB überprüfen lassen. Auch eine zusätzliche Prüfung durch das Bundesverwaltungsgericht ist möglich.Weiterführende Informationen:
Am 18. Mai 2019 berichteten die Basler Zeitung und andere Medien der Tamedia AG über die geplante Kampfflugzeugbeschaffung. Einige Fakten im Artikel sind falsch oder nicht ganz zutreffend.
Unter anderem heisst es, dass drei F-35A in die Schweiz kommen und die Kampfflugzeuge während der Flug- und Bodenerprobung jeweils über die Nacht auf einen Nato-Militärflugplatz im Nordosten Italiens überstellt werden, um zu verhindern, dass das hoch klassifizierte Flugzeug «heimlich ausgemessen» wird. Richtig ist: Die US Air Force stellt vier F-35A für die Flug- und Bodenerprobung zur Verfügung und die Kampfflugzeuge bleiben während dieser Zeit in der Schweiz. Weiter wird beschrieben, dass die Pilotenausbildung bei den US-Kampfflugzeuge in Teilen in den USA stattfinden werde. Richtig ist, dass – unabhängig vom gewählten Kandidaten – die ersten Schweizer Fluglehrer und Ausbildner für das Bodenpersonal im Herstellerland ausgebildet werden («train the trainer-Konzept»). Im Nachgang dazu soll weiteres Fachpersonal durch Schweizer Fluglehrer und Ausbildner für das Bodenpersonal in der Schweiz aus- und weitergebildet werden. Diese Vorgehensweise stellt den effizienten Wissenstransfer sicher.
Auch die «geheimen Boxen» sowie die Abhängigkeit der Schweiz von den Herstellerländern werden erwähnt. Hierzu folgende Information: Eine Abhängigkeit vom Hersteller und vom entsprechenden Land lässt sich bei allen Kandidaten nicht völlig vermeiden. Technologische Abhängigkeiten werden in der Evaluation bei allen Kandidaten sorgfältig geprüft und es wird analysiert, wie sich Anhängigkeiten reduzieren lassen.Am 20. April 2019 berichtete der Tages-Anzeiger im Artikel «Rheinhafen war Ziel von Terroristen» über einen geplanten Terror-Anschlag in Basel. Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) wurde dabei wie folgt zitiert: «Nach unserer Beurteilung sind die operativen Fähigkeiten des Islamischen Staates stark geschwächt. Deswegen erachtet der NDB gegenwärtig Anschläge in Europa als unwahrscheinlich.» Der NDB legt Wert darauf, dass sich diese Aussage nur auf direkt vom IS gesteuerte Anschläge bezogen hat und mit Anschlägen in Europa weiterhin gerechnet werden muss. Die Terrorbedrohung in der Schweiz ist seit November 2015 erhöht. Sie wird weiterhin massgeblich durch den «Islamischen Staat» und insbesondere seine Unterstützer und Sympathisanten geprägt, auch wenn der «Islamische Staat» im März 2019 in Syrien die letzten von ihm kontrollierten Gebiete verloren hat. Auch die Bedrohung durch die al-Qaida besteht fort.
In ihrem Artikel «VBS nimmt 120 Schweizer Gewerblern Arbeit weg» vom 3. Februar 2019 vermischt die SonntagsZeitung verschiedene Informationen und Phasen im Beschaffungsprojekt «Werterhalt DURO». Dazu stellt armasuisse klar: Fakt ist, dass für die erste Phase – die eigentliche Werterhaltung DURO – die Firma GDELS-Mowag rund 170 Unterlieferanten in der Schweiz unter Vertrag hat. Diese Schweizer Klein- und Mittelbetriebe führen Aufträge zuhanden der Mowag aus und profitieren so von diesem Beschaffungsauftrag. Das wurde immer so kommuniziert und daran wird auch weiterhin festgehalten.
Davon zu unterscheiden sind – in einer zweiten Phase – die künftigen Unterhalts- und Instandhaltungsarbeiten, welche am modernisierten Fahrzeug durch die Industrie zu erbringen sind. Für diese Arbeiten hat armasuisse ebenfalls Mowag als Materialkompetenzzentrum gewählt. Der Auftrag umfasst neben eigentlichen Instandhaltungsarbeiten auch weitere Aufgaben wie das Konfigurationsmanagement oder den Änderungsdienst sowie die Sicherstellung der technischen Systemintegrität. Das heisst, GDELS-Mowag überprüft die Machbarkeit von notwendigen Anpassungen während der Nutzung der Fahrzeuge. Sie dokumentiert und verwaltet alle Änderungen und ist somit verantwortlich für das Funktionieren der Duro-Flotte über den gesamten Lebenszyklus.
Mowag hat ihrerseits entschieden, für diesen Auftrag nicht mit einer Vielzahl kleiner und mittlerer Betriebe, sondern mit der Firma Scania Schweiz zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit mit Scania bezieht sich auf die Dauer der Garantiezeit. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dank dem breiten Netz von Scania einen umfassenden Service sicherstellen zu können. Dadurch wird eine bessere Wirtschaftlichkeit erzielt. Die Arbeiten werden aber in der Schweiz und damit von in der Schweiz angestellten Arbeitnehmenden ausgeführt. Nach wie vor werden die bestehenden Infrastrukturen der Logistikbasis der Armee (LBA) genutzt und die Instandhaltungsarbeiten werden grösstenteils weiterhin selber von der LBA ausgeführt.
Weiter zu unterscheiden sind die Instandhaltungsarbeiten an den noch nicht modernisierten Fahrzeugen. Hier liegt die Wartung in der Verantwortung der Logistikbasis der Armee (LBA) wobei diese im Rahmen ihrer eigenen Kapazität fallweise auch kleinere und mittlere Betriebe involviert hatte. Die Aussage, dass praktisch über Nacht die Aufträge gestoppt wurden, ist nicht korrekt.
2018
Der «Tages-Anzeiger» veröffentlichte am 12. November 2018 rund um die Vorkommnisse der seinerzeitigen Freistellung des Oberfeldarztes der Armee den Beitrag «Ausser Spesen nichts gewesen». Dazu stellt das VBS klar: Die Vorkommnisse sind aufgearbeitet. Bundesrat Guy Parmelin hat die nötigen Schritte in die Wege geleitet. Dazu gehören die Administrativ- und Disziplinaruntersuchungen und ein Bericht der Internen Revision VBS. Diese Untersuchungen haben Unregelmässigkeiten gezeigt. Bundesrat Guy Parmelin hat deshalb einen Kulturwandel im Umgang mit Spesen eingeläutet (siehe Medienmitteilung vom 22.9.2017 und Medienmitteilung vom 6.6.2018). Zu den getroffenen Massnahmen gehören insbesondere:
- Eine neue, über das ganze Departement gültige Weisung über Spesen, Anlässen und Abgabe von Geschenken. Sie standardisiert auch die Spesenprozesse und regelt die Verantwortlichkeiten und deren Kontrolle (in Kraft seit 1.9.18)
- Gegenseitige Einladungen zu Geschäftsessen sind nicht statthaft. Über Ausnahmen entscheidet der Vorgesetzte.
- Partnerinnen und Partner dürfen nicht zu Anlässen eingeladen werden
- Stärkung der Whistleblowing-Stelle, die wie bei der übrigen Bundesverwaltung bei der EFK und nicht mehr wie vorher bei der Armee selber angegliedert ist
Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates verfügt über alle ungeschwärzten Berichte. Sie kommt ebenfalls zum Schluss, «dass das VBS nach anfänglichen Fehlern und Fehleinschätzungen die nötigen Massnahmen getroffen hat, um die Vorwürfe umfassend und vertieft aufzuarbeiten und die dabei aufgedeckten Probleme anzugehen» (siehe GPK-Bericht). Der Bundesrat wird zu diesem Bericht noch Stellung nehmen.
«20 Minuten» veröffentlichte am 21. September 2018 den Beitrag «Bund überwies Pleite-Airline fast 2 Mio Franken». Die Rede ist von Skywork AG, welche am 29. August dieses Jahres ihr Grounding bekannt gegeben hat. Um weiterhin die Versorgungsflüge sowie Personen- und Materialtransporte der Armee sicherstellen zu können, übernimmt seit Mitte September bis voraussichtlich Ende November 2018 die zweitplatzierte Zimex Aviation AG diese Aufgaben.
Im Beitrag steht: «Bis anhin zahlte der Bund für die Versorgungsflüge ins Ausland rund 240'000 Franken monatlich. Der neue Anbieter dürfte hingegen rund 420'000 pro Monat kosten.» Mit dieser Aussage wird der Leser irregeführt, da der Eindruck entsteht, Zimex AG sei fast doppelt so teuer wie Skywork AG. Der Betrag der Zimex Aviaton AG in Höhe von 420'000 Franken pro Monat ist lediglich ein Kostendach, welches die Summenobergrenze aller durchgeführten Versorgungsflüge festhält. Dies entspricht nicht dem tatsächlich zu zahlenden Betrag. Ein Rückschluss auf die Preise basierend diesem Kostendach in Verbindung zu den bisherigen Zahlungen an die Skywork AG ist nicht sachgemäss. Der faktische Preisunterschied zwischen den beiden Airlines liegt bei 13 Prozent.In den Artikeln vom 22. Februar 2018 «Regierung Trump will der Schweiz Jets verkaufen» schreiben die Zeitungen «Der Bund» und der «Tages-Anzeiger» über die Anfrage von armasuisse respektive die Antworten der angeschriebene Staaten zur geplanten Evaluation der Schweiz für ein neues Kampfflugzeug. Dabei hält der Artikel in zwei Aussagen folgendes fest:
- Der Hersteller des F-35A Lockheed-Martin habe sich vor zehn Jahren bei der Evaluation für den Tiger-Teilersatz (TTE) zurückgezogen.
- Der Bund will die Kampfjetbeschaffung als «Government to Government»-Geschäft über die Bühne bringen.
Beide Aussagen sind nicht korrekt.
Richtig ist:- Für die TTE Evaluation im Jahr 2008 wurden die folgenden vier Hersteller angefragt: Boeing mit F/A-18 Super Hornet (USA), Dassault mit Rafale (Frankreich), EADS mit Eurofighter (Europa) und Saab mit Gripen (Schweden). Am 30. April 2008 teilte der US-Hersteller Boeing der armasuisse mit, dass er auf ein Angebot für den F/A-18 Super Hornet im Rahmen der TTE Evaluation verzichtet (Medienmitteilung vom 30. April 2008: Evaluation für den Tiger-Teil-Ersatz läuft planmässig – Flugzeughersteller Boeing verzichtet.)
- Der Hersteller Lockheed-Martin mit dem F-35 wurde für TTE Evaluation im Jahr 2008 nicht angefragt und war somit auch nicht unter den Kandidaten. Und: Es ist völlig offen, ob die Beschaffung als «Government to Government»-Geschäft (wie bei den Beschaffungen des F-5 und des F/A-18 sowie der versuchten Beschaffung Gripen) oder als «Company to Government»-Geschäft stattfinden soll. Ob das Geschäft mit der Regierung des Herstellerlandes oder mit dem Hersteller selbst abgewickelt wird, kann je nach Herstellerland variieren. Beide Varianten werden gleich behandelt.
Die Basler Zeitung hat in ihrem Artikel «Heute vor 22 Jahren» vom 25. Januar 2018 über den damaligen Kauf von 34 F/A-18 C/D für die Schweizer Luftwaffe berichtet. Sie schreibt, dass durch den Kauf dieses Kampfflugzeuges von US-Herstellern auch die Schweizer Wirtschaft profitierte. So seien Aufträge in Höhe von 435 Millionen Franken an Schweizer Firmen vergeben worden.
Diese Summe ist nicht korrekt. Richtig ist: Insgesamt konnten an die Schweizer Industrie zusätzliche Aufträge in Höhe von 2,5 Milliarden Franken vergeben werden, wobei 491 Mio. Franken aus direktem Offset stammen (z.B. Befähigung zur Endmontage von 32 der 34 F/A-18 C/D in der Schweiz). Die Beschaffung der F/A-18-Kampfflugzeuge kostete insgesamt 3,15 Milliarden Franken.
2017
Zu den Artikeln im Sonntagsblick vom 3. Dezember 2017 über die persönlichen Dienstfahrzeuge der Berufsmilitärs und der Verwaltungsfahrzeuge unterstreicht das VBS folgende grundlegende und wichtige Fakten, die im Artikel nicht erwähnt wurden: Das militärische Personal bezahlt jeden Monat eine Pauschale zur Nutzung des Dienstfahrzeugs. Diese Lohnabzüge betragen jährlich mehr als 5,5 Millionen Franken. Durch den Verkauf der persönlichen Dienstfahrzeuge werden jedes Jahr Einnahmen für die allgemeine Bundeskasse von rund 3 Millionen Franken generiert.
Bei den allgemeinen Verwaltungsfahrzeugen ist der Anteil des VBS aus folgenden Gründen höher als bei den übrigen Departementen:- Transporte der völkerrechtlich geschützten Personen mit Sonderschutzfahrzeugen (für alle Departemente) aufgrund der aktuellen Gefährdungslage
- ausländische Militärbesuche
- grösstes Departement mit rund 12‘000 Voll- u. Teilzeitangestellten
- Truppentransporte der Miliz mit Kleinbussen und Cars; dies weil es ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist, die Anzahl Fahrten mit grossen Fahrzeugen klein zu halten.
Der «Blick» berichtete am Samstag, 18. November 2017, dass das VBS den Bereich Cyber-Defence nicht genügend schnell aufbaue. Politiker fordern gemäss dem Medienbericht mehr Tempo. Das VBS stellt in diesem Zusammenhang folgendes klar:
Der Bereich Cyber-Defence wird im VBS prioritär behandelt. Der Chef VBS hat immer betont, dass die Cyber-Abwehr neben der Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen und der Bodengestützten Luftabwehr sowie der Modernisierung der Bodentruppen erste Priorität hat. Den Vorwurf, der Cyber-Bereich werde zu wenig schnell aufgebaut, weist das VBS zurück. Weiter weisen wir darauf hin, dass der Lead der Nationalen Strategie (NCS) zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken beim eidgenössischen Finanzdepartment liegt.
Fakt ist: Der Chef VBS hat im Juni 2017 den Aktionsplan Cyber-Defence verabschiedet. Der Aktionsplan soll bis im Jahr 2020 umgesetzt sein. Der Bericht ist öffentlich und auf der Internetseite VBS einsehbar.
Weiter hat der Chef VBS einen Cyber-Delegierten ernannt. Die Cyber-Abwehr wurde bei der Führungsunterstützungsbasis zentralisiert. Die bestehenden Cyberabteilungen des VBS wehren täglich erfolgreich Cyberangriffe ab. Sie konnten zudem auch im Fall RUAG die nötigen Unterstützungsarbeiten leisten und auch den Angriff auf das VBS vom letzten Sommer bewältigen. Insgesamt arbeiten heute 50 Cyber-Spezialisten im VBS; zivile Verwaltungsangestellte mit hervorragenden Informatikkenntnissen. Die Stellenbesetzung erfolgte aufgrund der Sparmassnahmen beim Bund durch interne Verschiebungen. Weitere Stellen werden so rasch als möglich ausgeschrieben. Bis 2020 sollen rund 100 Stellen besetzt werden. Aufgrund der vom Parlament bereits für das Jahr 2017 beschlossenen und für das Jahr 2018 angekündigten Sparmassnahmen beim Bundespersonal sind auch die 100 geplanten Stellen nur haushaltsneutral zu besetzen. Kurz: Es steht dafür seitens des Parlamentes kein zusätzliches Geld zur Verfügung.
In der Armee wird der Bereich Cyber künftig eine eigene Operationsphäre sein; entsprechend wird eine Doktrin entwickelt, um den Einsatz dieser Mittel sowie die Ausbildung für diesen Bereich zu regeln. Mit der Umsetzung der Weiterentwicklung der Armee werden ab dem 1. Januar 2018 Milizsoldaten im Cyber-Bereich ausgebildet. Im Moment verfügt die Armee über ca. 100 Armeeangehörige, die aufgeboten und in diesem Bereich eingesetzt werden können. Die Armeeangehörigen bringen ihre Fachausbildung und -kenntnisse aus dem zivilen Leben mit. Konkret bedeutet das, dass diese Milizsoldaten bereits minimal über ein Bachelor im IT-Bereich oder mehr verfügen.
Eine eigentliche «Cyber-Rekrutenschule» kann die Armee im Moment nicht anbieten. Die im Cyber-Bereich eingesetzten Angehörigen der Armee erhalten aber eine spezifische Ausbildung, damit sie den Bedürfnissen der Armee entsprechend eingesetzt werden können. Sie werden zur Verstärkung der Berufselemente und nicht als eigenständige militärische Einheiten eingesetzt. Künftig sollen dort 400 bis 600 Soldaten (IT-Spezialisten) eingeteilt werden.
Weiter erfolgt ab 2018 der Aufbau des «Cyber-Defence CAMPUS». Hier werden die benötigten Fachkräfte ausgebildet. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit den Hochschulen und den Betreibern kritischer Infrastrukturen.Weiterführende Informationen:
Die schweizerische Konsumenten- und Beratungszeitschrift «Beobachter» hat in der Ausgabe vom 26. Mai 2017 einen Artikel rund um das Beschaffungswesen des VBS im Allgemeinen und zu diversen konkreten Beschaffungsvorhaben im Speziellen veröffentlicht. Das VBS stand während den Recherchen im Vorfeld dieser Publikation mehrfach mit den Journalisten in Kontakt und im Austausch. Nachfolgend einige Richtigstellungen zu im Artikel gemachten Aussagen zu laufenden Beschaffungen.