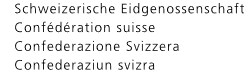Actualités
Rectifications et clarifications du DDPS
Le DDPS traite des sujets d'intérêt public tels que la sécurité, l'armée, la protection de la population et le sport. Il est l'interlocuteur des médias ainsi que des citoyennes et des citoyens en cas de questions sur ces sujets. Vous trouverez ici des mises au point et clarifications.