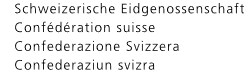Sicherheit
Sicherheitspolitik
Die Schweizer Sicherheitspolitik schützt das Land und seine Bevölkerung vor Bedrohungen und Gefahren und trägt zur Stabilität und zum Frieden über die Grenzen hinaus bei.
Weiterentwicklung der Dienstpflicht
Die Dienstpflicht wird weiterentwickelt, um Armee und Zivilschutz zu stärken. Ziel ist eine breitere Beteiligung und langfristige Sicherung der Einsatzbereitschaft.
Nachrichtendienst
Der Nachrichtendienst des Bundes schützt die Schweiz durch Prävention, Lageanalysen und die Früherkennung von Bedrohungen für die Sicherheit von Bevölkerung und Staat.
Schweizer Armee
Die Schweizer Armee verteidigt das Land, unterstützt zivile Behörden bei Bedarf und fördert den internationalen Frieden.
Cybersicherheit und Cyberdefence
Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport schützt die Schweiz vor Cyberangriffen und unterstützt bei der Bewältigung von Cybervorfällen.
Krieg in der Ukraine
Analyse der Ukraine-Krise und ihrer Auswirkungen auf die Schweiz: Informationen zu sicherheitspolitischen Entwicklungen und humanitärer Unterstützung.